Neulich gab es Bratkartoffeln und Spiegelei zum Abendessen. Ein ebenso einfaches wie sättigendes Gericht. Vor allem aber schnell zuzubereiten, denn Zeit und Lust für aufwendige Küchenakrobatik konnte oder wollte ich an diesem besagten Abend nicht aufbringen. Viel wichtiger ist, dass mir die Kombination aus Bratkartoffeln und Spiegeleiern schmeckt. Dieses Mal jedoch nicht. Waren die Zutaten schlecht? Laut Etiketten war alles in Ordnung. Auch die Zubereitung unterschied sich kein bisschen von den vorherigen Malen. Bis heute weiß ich nicht, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Weshalb ich die Geschichte jetzt hervorkrame? Weil es mir mit Transistor ähnlich erging.
Transistor hatte bereits mit seinem allerersten Trailer mein Bauchgefühl für sich gewonnen. Das war eines dieser Videos, nach denen man höchstens eine vage Vorstellung davon hat, was da auf einen zukommt. Irgendwas mit Rundenkämpfen, großen Schwertern, tollem Artdesign und vielversprechendem Soundtrack. Es hat einfach Klick gemacht, ohne dass man weiß wieso. Das Gehirn gibt einem zu verstehen: „Das wird dir gefallen. Freu dich gefälligst drauf!“.
Nach den fünf Stunden, die ich nun mit Transistor verbracht habe, kommt mir aber lediglich ein dumpfes „Hmm“ in den Sinn. Kein anerkennendes Nicken. Kein Hochgefühl. Schon gar nicht lasse ich das Ganze im Geiste nochmal Revue passieren. Das alles schmeckte nicht so wie erwartet. Auch hier kann ich den Finger nicht genau auf die Wunde legen. Versuchen wir’s trotzdem.
Fangen wir dafür nochmal ganz von vorne an. Zu behaupten, Transistor stoße den Spieler ins kalte Wasser, wäre noch eine milde Umschreibung des Spielbeginns. Wir sehen die Protagonistin Red, wie sie ein riesiges Schwert aus einem Leichnam zieht. Plötzlich plappert das Ding munter drauf los und hört bis zum Abspann nicht damit auf. Ein paar Schritte weiter greifen sterile Roboterkonstrukte an. Das Spiel wechselt in eine Art Pausenmodus, in dem diverse Angriffe und sonstige Aktionen geplant werden können. Diese werden nach einem Druck auf die Leertaste in rasend schnellem Tempo hintereinander abgespult. Farbenfrohe Explosionen füllen den Bildschirm, ich sammle unter Zeitdruck irgendwelche Kapseln ein und habe genau gar nichts kapiert.
Doch damit nicht genug. Womöglich wurde ich von anderen Spielen über die Jahre weichgespült, aber beim unübersichtlichen Fähigkeitenmenü von Transistor fragte ich mich schon, ob mir ein Abschluss in Elektrotechnik oder Informatik weiterhelfen könnte. Ist der erste Schock nach etwa ein bis zwei Stunden überwunden, offenbaren sich jedoch die vielen Möglichkeiten des eigenwilligen Kampfsystems. Grundsätzlich lässt sich jede Fähigkeit mit jeder anderen kombinieren. So kann der ganz normale Nahkampfangriff mit Flächenschaden und Lebensdiebstahl aufgewertet werden. Zugleich könnten die beiden Eigenschaften aber auch als eigenständige Attacken genutzt und mit anderen verstärkt werden. Dieser mannigfaltige Baukasten und seine Erprobung in den Kämpfen, ist eine der großen Stärken von Transistor. Zugleich stellt dieses Feature aber auch die Weichen dafür, ob man das Spiel bis zum Ende durchsteht oder ihm schon vorher den Laufpass gibt.
Denn bricht man es auf das Wesentliche herunter, dann kämpft man sich von einer Arena zur nächsten. Erst wenn alle Roboter in einem Bereich besiegt sind, geht die Reise weiter. Die eigentlich wunderschön gestaltete Metropole Cloudbank verkommt somit zur reinen Kulisse. Aber was für eine! Wie schon in Bastion wissen Supergiant Games mit einem wunderschönen Artdesign zu begeistern. Atemberaubende Licht- und Farbkompositionen bestimmen Reds Weg durch die verschlungenen Häuserschluchten. Wenn dann noch der wieder mal großartige Soundtrack von Darren Korb in den richtigen Momenten einsetzt, ist mit Transistor plötzlich alles in Ordnung.
Doch so schnell diese Glückseligkeit einsetzte, so schnell ist sie auch wieder vorbei. Spätestens dann, wenn man sich darüber wundert, warum sich Red überhaupt durch Cloudbank kämpft. Eine Roboterinvasion dürfte für viele Spieler als Grund ausreichen. Transistor will aber noch viel mehr erzählen: Hinter der Maschinenarmee steckt vermutlich eine vierköpfige Gruppe, die höchstwahrscheinlich auch für das Verschwinden der einflussreichsten Persönlichkeiten Cloudbanks verantwortlich ist. Das ist ganz bewusst so vorsichtig ausgedrückt, weil ich mir absolut nicht sicher bin, die Story kapiert zu haben.
Das ist umso ärgerlicher, weil die Story eigentlich nicht komplex ist, sondern nur viel zu kompliziert erzählt wird. Transistor verzichtet nämlich darauf, von Anfang an ein umfassendes Bild der Geschehnisse zu zeichnen, sondern wirft dem Spieler lediglich ein paar Infohappen zu. So vielversprechend ein solcher Einstieg auch sein mag, so belanglos wird das Ganze im weiteren Spielverlauf. Gerade gegen Ende merkt man dem Spiel an, dass es auf ein großes Finale zusteuert, für das die zugrunde liegende Geschichte aber schlichtweg zu klein ist.
Aber ist das jetzt der große Kritikpunkt, der bei Transistor für einen so schalen Beigeschmack sorgt? Nein, wirklich nicht. Mein Problem ist die konzeptionelle Nähe zu Bastion. Das ist schade, weil ich Bastion maximal okay fand und mir von Transistor deutlich mehr erhofft hatte. Die Parallelen zwischen beiden Spielen sind unübersehbar: Stummer Hauptcharakter und ein stetig quatschender Erzähler, der auch hier wieder von Logan Cunningham gesprochen wird? Check. Eine leere, von einer unerklärlichen Katastrophe heimgesuchte Welt? Jup. Individuelle und optionale Anpassung des Schwierigkeitsgrades mittels sogenannter Begrenzer? Auch wieder mit dabei. Enge Verknüpfung von Soundtrack und Spielgeschehen? Ihr ahnt es sicher…
Das klingt vermutlich nach einer wahnsinnig gehässigen Suche nach Kritikpunkten. Mir ist bewusst, dass da enttäuschte Erwartungen eine große Rolle spielen. Es ist schon paradox: Ich habe mich auf ein interessantes Action-RPG mit coolem Kampfsystem, wunderschönem Artdesign in einer futuristischen Welt gefreut und genau das bekommen. Das sagt mir zumindest mein Kopf. Mein Bauch besteht aber weiter darauf, dass ich es nur mit einem mutlosen Bastion-Remix zu tun habe. Vielleicht sollte ich ihn einfach mit Bratkartoffeln und Spiegelei zum Schweigen bringen und trotzdem meinen Spaß damit haben.
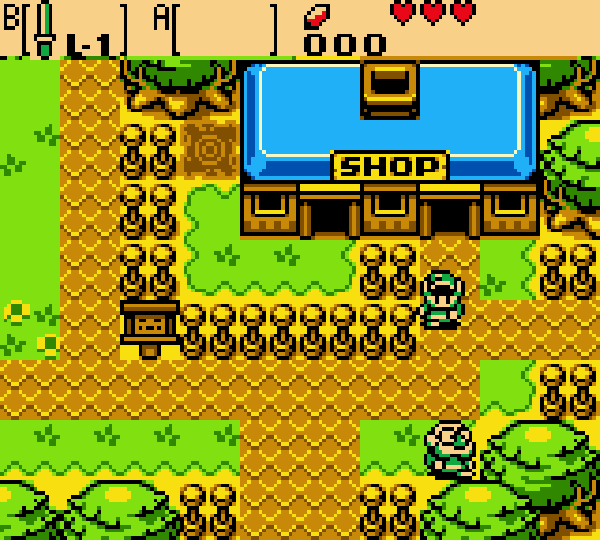
















1 Kommentar
Habe bisher zwei Stunden gespielt und exakt dasselbe gefühlt. Lohnt sich vermutlich für mich nicht, noch mehr Zeit zu investieren. Ich habe Bastion im Gegensatz dazu aber sehr gemocht. Einfach weil ich mich storytechnisch wesentlich besser abgeholt fühlte.