Viele werden sich vielleicht schon gefragt haben, was aus der H.P. Lovecraft-Umsetzung Call of Cthulhu geworden ist. Erst war es lange Jahre nur für den PC angekündigt, dann sollte es plötzlich nur für die XBox erscheinen, doch nun bringt Ubisoft auch die PC-Version in den Handel und zwar netterweise gleich zum Midprice von 30€. Und weshalb man den Entwicklern dafür aus Dankbarkeit auf Knien danken und einen tibetanischen Gebetsschal aus Lamawolle stricken sollte, erklärt folgender Artikel.
Call of Cthulhu; eigentlich sogar Call of Cthulhu – Dark Corners of the Earth.
Damit qualifiziert sich das Spiel nicht nur für einen der längsten Titel dieses Jahres, sondern auch für die feuchteste Aussprache. Bereits im Vorspann wird eine Warnung für schreckhafte Naturen ausgesprochen, die vorsorglich die Herztabletten in Reichweite haben sollten. Im Hauptmenü geht der Grusel dann weiter: Mit der Maus markierte Schriften verschwimmen und verzerren sich, dazu tauchen im Hintergrund schemenhafte Fratzen auf, die einem wenig ermutigende Sprüche zuflüstern. Nicht schlecht für den Anfang.
Die amerikanische Arkham-Irrenanstalt in den 20er Jahren. Ratten wuseln auf dem Boden, ein glatzköpfiger Aufseher legt erst mal eine Schallplatte auf und macht eine Routinekontrolle. Überall auf den Gängen liegen, stehen und kriechen Insassen. Arme versuchen durch die Gitterstäbe am Türfenster etwas zu ergreifen. Ein Mann sitzt apathisch in seiner Zelle, rote Zeichen sind an Boden und Wände gekritzelt. Sie wurden mit Blut geschrieben, genauer gesagt: mit seinem Blut. Er rollt panisch mit den Augen; der Wahnsinn ist ihm ins Gesicht geschrieben, während er wirr in seinem Tagebuch blättert. Fast könnte man meinen, dass er gezwungen wurde alle 147 Folgen von „Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft“ anzuschauen.
Sorgsam bereitet er seinen Selbstmord durch Erhängen vor, doch im entscheidenden Moment schaut der Wärter nach dem Rechten und kann ihn gerade noch abstützen.
Schnitt.
Sechs Jahre zuvor. Der zukünftige Zelleninsasse, Jack Walters, seines Zeichens leicht verwahrloster Privatdetektiv, wird abends während eines Gewitters zu einer alten Villa mit verrückten Yith-Anhängern gerufen. Ein wichtiger Informant möchte ausschließlich mit ihm reden und lehnt jedweden Kontakt mit der Polizei ab. Ab hier übernimmt der Spieler. Die Polizisten haben bereits das Haus umstellt und sind in Position gegangen, um ihrem ehemaligen Kollegen notfalls Feuerschutz zu geben. Plötzlich fallen Schüsse, ein Kollege sinkt getroffen zu Boden, Chaos bricht aus.
Man betritt das Haus durch die Seitentür und stöbert ein wenig herum. Im Kamin knistert noch die Glut, während man Bilder und andere Gegenstände mit der Benutzen-Taste einer genaueren Betrachtung unterzieht und Jack ein paar Zeilen dazu entlockt. Im ersten Stock macht man eine sehr kurze Bekanntschaft mit einigen der feuernden Sektenfreaks. Sie scheinen Jack zu kennen, doch leben nicht lange genug, um die Angelegenheit detaillierter auszuführen. Im Keller – die Tradition verpflichtet – stapeln sich leider keine Getränkekartons, sondern Leichen und noch etwas bedeutend Schlimmeres, das schließlich zu Jacks Einlieferung in Arkham führen wird…
Bereits diese erste Szene wurde mit soviel Liebe zum Detail gestaltet, dass es eine wahre Freude ist. Der Regen prasselt schön gemütlich auf die Erde, die Scheinwerfer der Oldtimer werfen ein sanftes Licht auf die Szenerie, Wassertropfen laufen am Bildschirm herunter, und an den Klippen branden die Wellen der rauen See. Alles wirkt stimmig bis ins letzte Detail; die Atmosphäre ist dichter als Zehntklässler während einer Klassenfahrt.
Diese Detailverliebtheit ist das ganze Spiel über beständig. Ich bin ja sowieso ein Fan der 20er Jahre und bekomme beim Anblick der ganzen alten Wagen und Kleidungen feuchte Augen. Technisch gesehen ist die Engine nicht auf der Höhe der Zeit. Leider konnte ich nicht in Erfahrung bringen, welche Engine die Entwickler verwendet haben, vermutlich eine Eigenentwicklung. Besonders die Animationen und Spezialeffekte wirken reichlich altbacken. Zum Ende hin gibt es jedoch einige wirklich schöne Stellen zu sehen. Die Grafik vermiest zwar nicht den Spielspass und erfüllt durchaus ihren Zweck; eine bessere Engine hätte gruseltechnisch aber wahre Wunder wirken können.
Die Umgebungen sind zwar extrem linear aufgebaut, aber dafür sehr ordentlich und abwechslungsreich und fangen das Flair des Amerikas der 20er Jahre perfekt ein. Richtig gut gefallen haben mir kleine Details, wie Käfer und Motten, die über den Boden krabbeln und ihre Kreise um Kerzen drehen.
Auf die Entfernung kommt ein leichter Weichzeichner-Filter zum Einsatz, der dem Spiel ein etwas surreales Aussehen verleiht. Zusätzlich besitzt das Bild einen ganz leichten Rauschfilter, ähnlich der Silent Hill-Serie, jedoch nicht so stark. In den Zwischensequenzen, die per Spielgrafik realisiert werden, wird eine Art Filmeffekt mit deutlich sichtbarem Rauschen und wandernden Streifen verwendet.
Dass die Grafik von der Konsole portiert wurde, ist in erster Linie an den Texturen sichtbar, die zwar nicht gerade völlig verwaschen sind, aber trotzdem etwas detaillierter hätten ausfallen können. Dennoch erzeugt die Grafik ein düsteres, dreckiges und ausgesprochen unheimliches Bild.
„The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown.“
Nachdem Jack wieder als geheilt entlassen wurde, erhält er den Auftrag ins Küstenstädtchen Innsmouth zu reisen und einen verschwundenen Ladenbesitzer ausfindig zu machen. Das Städtchen macht einen recht heruntergekommenen und wenig einladenden Eindruck. An den buckeligen und hünenhaften Einwohnern, die irgendwelche feindseligen Parolen nuscheln, sieht man eindrucksvoll, was jahrelange Inzucht so alles anrichten kann.
Jacks Nachforschungen bleiben natürlich nicht lange unbemerkt, und so hat er bald ¾ der Stadtbewohner auf den Fersen. Sein Hotelzimmer wird des Nachts gestürmt, und man hat als Spieler alle Hände voll zu tun, um aus dem Schlamassel wieder heil herauszukommen. Türen mit Schränken zu versperren und vorher abzuriegeln ist schon mal nicht schlecht. Dann noch flink aus dem Fenster geklettert und alles ist vorbei? Mitnichten. Jetzt geht der „Spass“ erst so richtig los. Über Dächer, durch Korridore und von einem Hinterhof zum anderen wird man von den fetten Cholerikern gejagt. Da man keine Waffen zur Hand hat, muss man stets die Beine in die Hand nehmen. Natürlich nur solange diese noch keine blutigen Stumpen sind, die bestenfalls zum Davonhumpeln ausreichen.
Statt 100 Lebenspunkten, wie in anderen Spielen, gibt es nämlich ein ausgeklügeltes Schadenssystem, dass die Art der Verletzung berücksichtigt. Zur Behandlung der Kratzer, Knochenbrüche, Beulen und Vergiftungen steht allerhand Verbandszeug zur Verfügung, das Jack in einem kleinen Arztköfferchen mit sich herumschleppt. Sehr schön sind auch die Auswirkungen der Verletzungen auf das Spiel: Auge Matsch? Schon gibt’s Blutflecken auf dem Schirm. Beine kaputt? Dadurch wird Jack merklich langsamer. Angeknackste Arme lassen ihn schlechter zielen, und bei Blutverlust verliert das Bild immer mehr an Farbe.
„The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents.“
Doch nicht nur der körperliche Schaden wird vom Spiel ernster als üblich genommen. Auch Jacks Psyche, die sowieso nicht gerade zu den stabilsten ihrer Art gehört, wird simuliert. Sieht er etwas Nervenaufreibendes, z.B. übel zugerichtete Leichen oder ein Monster mit eindeutig zu viel Augen und Tentakeln, fängt er an zu keuchen und die Sicht verschwimmt. Sollte es gar noch schlimmer kommen, verzerrt die Sicht deutlich stärker, und Jack fängt an Stimmen zu hören, die ihm irgendwelche Sachen zuflüstern. Tiefgreifende Selbstgespräche stehen übrigens auch auf dem Plan. Wenn Jack vollends eine Klatsche hat, kann auch Folgendes passieren: Entweder er erkrankt an unheilbarem Schwachsinn oder – wenn er zufällig gerade ein Schießeisen in der Hand hält – richtet die Waffe gegen sich. An einigen bestimmten Szenen hat Jack gar Halluzinationen und macht eine Gedankenreise zurück in die Anstalt, wo nun öfter mal Blut in dicken Strömen von den Wänden fließt und verkrampft-zuckende Gestalten in Rollstühlen herumstehen, unentzifferbare Laute gurgelnd. Soviel zu dem selbstmordgefährdeten Psycho-Detektiv, den man verkörpert. Muss man ihn nicht einfach gern haben?
So ungefähr am Ende des ersten Drittels findet Jack endlich eine Waffe, und das Spiel wandelt sich von der Mischung aus Silent Hill und Thief, zu einer Melange aus Undying und Alone in the Dark. Und macht dabei eine nicht mehr ganz so gute Figur wie zuvor. Gerade die Hilflosigkeit gegenüber den missgestalteten Einwohnern und die teilweise nervenzehrenden Versteckspiele haben vorher einen Großteil des Reizes ausgemacht und eine Atmosphäre der permanenten Bedrohung aufgebaut. Mit einer Waffe in der Hand kann man sich jedoch – trotz relativ wenig Munition – recht sicher fühlen. Ein paar gezielte Schüsse und die Gegner sind erledigt. Kein Wunder, schließlich ist die KI sehr dürftig ausgefallen.
Danach geht’s Schlag auf Schlag: Neben der anfänglichen Brechstange und Pistole füllt sich das Inventar schnell mit Schrotflinte, Revolver, Tommy-Gun und Karabiner. Darunter leidet der Gruselfaktor leider merklich. Geschossen werden kann zwar aus der Hüfte, aus Ermangelung eines Fadenkreuzes schießt man damit aber nur Fahrkarten. Über Kimme und Korn sind hingegen gezielte Schüsse möglich, auf Dauer schlafen Jack dabei jedoch die Arme ein. Weichei!
Die Schusswaffen sind daher auch einer der größten Schwachpunkte des Spiels. Mit einer Waffe in der Hand geht nun mal ein Großteil der Spannung und des wohligen Gruselns flöten. Punkt. Seinen Tiefpunkt erreicht das Spiel in einer Raffinerie, in der es wenig gruselig zugeht. Stattdessen stürmt man wie in handelsüblichen Weltkriegsshootern ein MG-Nest am Eingang, stößt auf Gegnerhorden, die ständig wie von Zauberhand neu auftauchen und bedient irgendwelche langweiligen Maschinen. Immerhin gibt’s gegen Ende des Levels einen netten Zwischengegner.
Doch auch das spätere Leveldesign gibt Anlass zum Klagen. Die Villa vom Anfang? Toll, schöne Atmosphäre. Innsmouth? Hervorragend, so sollten Gruselspiele sein. Die Abwässerkanäle? Wow, Horror par excellence. Aber die Levels danach? Ach du meine Güte! Ständig soll ich mich an Dutzenden von Einwohnern vorbei schleichen, was aufgrund ihrer anscheinend hellseherischen Fähigkeiten fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Schnell vorbeirennen und in einer dunklen Ecke die Gegner feuernd zu erwarten ist weitaus zeit- und nervenschonender. An einigen Stellen geht es erst weiter, wenn alle Gegner getötet wurden. Das ist vielleicht bei Serious Sam Usus, aber doch bitte nicht in einem Horror-Spiel! Den Gipfel sinnloser Action erreicht das Spiel zu Beginn des letzten Drittels, wo man als völlig ungeübter Schütze und debiler Detektiv die Kontrolle über ein Schiffsgeschütz übernehmen soll, um Magier an der Küste wegzupusten. Damit nicht genug: Ständig prasseln neben echten Wellen auch dutzende Gegnerwellen auf den Spieler ein, so dass man gegen Ende der Szene schätzungsweise 40-50 Monster erledigt hat.
Stellenweise hatte ich auch das Gefühl, das Spiel versuche unterschwellig mich zum Mechaniker auszubilden. Die Anzahl an Ventilen und Rädchen, die hier gedreht werden müssen, ist schon fast rekordverdächtig. Das Schöne dabei ist, dass man vorher eigentlich nie so genau weiß, was das Drehen eigentlich bewirkt. Zum Beispiel fängt auf dem oben genannten Schiff plötzlich der Maschinenraum an zu rattern und zu rumpeln. Wer soll das Problem wieder mal beheben? Klar, der Spieler. Falsches Ventil geöffnet? Tja, Pech gehabt, schon fliegt einem die Kiste um die Ohren. Game Over. Zum Glück liegt der letzte Speicherpunkt nur fünf Minuten entfernt zurück. Ich kann mir das Gespräch mit dem Matrosen ja ruhig noch ein paar Mal anhören, bis ich das richtige Ventil erwische…
Richtig gelesen, es gibt mal wieder die allseits beliebten (*hust*) Speicherpunkte. Die Konsolenfreaks werden jetzt wahrscheinlich schon wieder mit den Augen rollen und denken: „Jetzt kommt wieder die übliche Kritik am Speicherpunktsystem, dabei kommen wir schon seit Ewigkeiten problemlos damit klar.“ Das ist so eine Sache. Klar, Speicherpunkte zwingen zum überlegten Handeln. Einfach mal den Raum stürmen und nachschauen, wer einen da so erwartet, ist nicht drin. Dennoch ist es ziemlich ärgerlich, wenn man nach dem Scheitern immer und immer wieder die gleiche Zwischensequenz anschauen (die Abbrechfunktion scheint ein wenig fehlerhaft zu sein) und noch mal fünf bis zehn Minuten bis zur Todesstelle latschen muss, nur, um eventuell erneut zu sterben. Außerdem: Undying hatte eine komfortable Quicksave-Funktion; hatte ich deswegen weniger Spass, war der Gruselfaktor geringer? Wohl kaum.
Der letzte Kritikpunkt betrifft die Steuerung. Prinzipiell gefallen mir Spiele, die auf ein HUD im üblichen Sinn verzichten, z.B. Chronicles of Riddick. Die Visualisierung von Schäden ist bei Call of Cthulhu wirklich sehr schön gemacht. Auch die fehlende Munitionsanzeige nimmt ein wenig Schnelligkeit aus dem Spielablauf. Jedoch tauchen damit auch einige unschöne Probleme auf. Ich bin während einer Verfolgungsjagd schon des Öfteren den Weg alles Irdischen gegangen, nur weil Jack so schlau war, eine Tür zu öffnen statt zu verriegeln. Aufgrund des fehlenden Fadenkreuzes ist es oftmals reine Glückssache, den Riegel der Tür zu treffen. Außerdem bleibt Jack gerne mal an Leitern kleben und weigert sich loszulassen. Gerade wenn einige Leitern nebeneinander sind, fühlt man sich wie eine Fliege am Klebestreifen.
„That is not dead which can eternal lie,
And in stranger aeons even death may die.“
Das war’s dann aber auch mit der Kritik (war ja auch genug…). Über die Probleme mit der Steuerung sieht man mit der Zeit wohlwollend drüber hinweg, und die gute Story motiviert trotz einiger suboptimaler Levels zum Weiterspielen.
Am Ende bleibt das Gefühl ein grafisch und spielerisch etwas altmodisches Action-Adventure beendet zu haben, dass wohl stellenweise gerne etwas „cooler“ wirken möchte, als es eigentlich nötig hat. Etwas weniger Action wäre in vielen Abschnitten deutlich besser gewesen. Denn gerade die herrlich antiquiert wirkende Optik und der wenig heldenhafte Hauptcharakter machen für mich einen Großteil des Reizes aus. Da braucht es kein stupides Dauerballern.
Trotzdem ist Call of Cthulhu bisher meine persönliche Überraschung des Jahres. Aufgrund teilweise herber Kritikpunkte zwar mit Sicherheit nicht perfekt, aber dennoch eine schöne Abwechslung zu vielen angeblichen Grusel-Shootern á la F.E.A.R., das für mich nur eine Einschlafhilfe im Beton-Look darstellt. Wer Spiele im Stil von Realms of the Haunting oder des eher unbekannten Nosferatu mag, sollte Call of Cthulhu unbedingt eine Chance geben.
„My fiction can’t be compared with Poe’s or Machen’s, but I take no less pleasure in writing it on that account.“
Wer auf den Geschmack gekommen ist und noch mehr über den Cthulhu-Mythos und das Touristenparadies Innsmouth erfahren möchte, dem seien folgende Werke von Lovecraft empfohlen: In dem Buch „Schatten über Innsmouth“ werden die Hintergründe des Küstenstädtchens näher beleuchtet. Wer noch mehr Geschichten lesen möchte, ist mit der Sammlung „The Best of H.P. Lovecraft“ gut bedient, die auch „Schatten über Innsmouth“ beinhaltet. Wer eher auf Hörbücher steht, dem sei das sehr gut gemachte „Der Schatten über Innsmouth“ empfohlen.

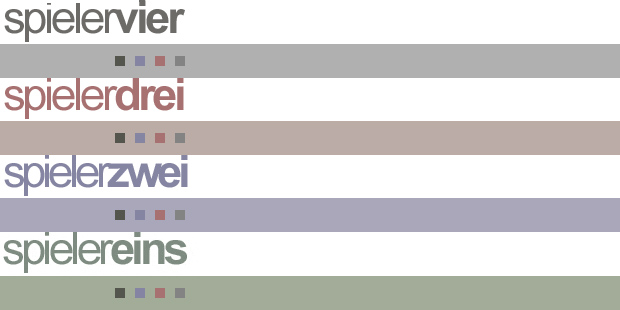









Neueste Kommentare