
Die Entwickler haben sich bei Prey am etwas billigen „Walker, Texas Ranger“-Leitmotiv orientiert, laut dem Indianer unfassbar edel und selbstlos sind und im Einklang mit der Natur und den Geistern ihrer Vorfahren leben. Ab und zu zaubern sie noch ein bisschen, wenn es die Situation erfordert, ansonsten halten sie bedeutungsschwangere Reden über die Menschheit.
Realistischer wäre es wohl, wenn der Hauptcharakter Gras rauchen würde, ein Alkoholproblem hätte und sich den Weg durch ein gigantisches Kasino kämpfte, welches auf dem Rücken seiner Vorfahren erbaut wurde…
Apropos: Chuck Norris würde das Spiel sicherlich in einem einzigen Level schaffen und die Aliens mit Roundhouse-Kicks auslöschen.
Der Beginn von Prey ist definitiv einer der besten, die ich in letzter Zeit erleben durfte. Das liegt allerdings nicht an Hauptdarsteller Tommy, der sich in den ersten Minuten als asoziales Arschloch oberster Kanüle outet und nicht nur seinen Großvater Enisi und seine Freundin Jenny verbal vor den Kopf stößt, sondern dies auch kurz darauf physisch bei zwei Kneipenbesuchern im Zusammenspiel mit einer Rohrzange eindrucksvoll demonstriert. Dafür entschädigt die liebevolle Gestaltung des besagten Trinkschuppens: Man kann schon gut und gerne 20 Minuten allein damit verbringen, sich verschiedene, sehr geile Musikstücke (u. a. SOiL – „Forever Dead“ u. Judas Priest – „You Got Another Thing Coming“) in der Jukebox anzuhören und nebenbei an zwei Pokerautomaten, einem einarmigen Banditen und dem Pac-Man-Klon „Rune Man“ daddeln. Weiterhin besteht die Möglichkeit sich Ausschnitte des kultigen Propagandafilms „Duck & Cover“ der amerikanischen Regierung über Atomwaffen anzuschauen (eine Zeitung oder Picknickdecke über den Kopf zu ziehen reicht bei einem Nuklearschlag völlig aus), sowie einige Bilder aus W. Lee Wilders „Killers from Space“ aus dem Jahre 1954. Trashig.
Sobald die zwei Gäste demoliert auf dem Boden dösen, kommen auch schon die Aliens angetanzt. Nun ja, eher angeflogen. Das Dach wird spektakulär aufgelöst und grüne Suchstrahler wandern umher und beamen neben Fernseher, Automaten und anderen Einrichtungsgegenständen auch die drei Protagonisten ins Raumschiff, während dazu „(Don’t Fear) The Reaper“ von Blue Öyster Cult läuft.
Es folgt eine Rundfahrt durch die Empfangshalle der so genannten Alien-Sphäre, bei der man die Örtlichkeiten der nächsten paar Stunden bewundern kann. Neben Tommy, Jen und Enisi sind natürlich auch andere Erdbewohner Opfer einer Entführung geworden und werden nun ebenfalls wie Schlachtvieh am Fließband durch die Gänge transportiert. Doch Tommy hat Glück im Unglück: Ein menschenähnliches Wesen platziert eine Sprengladung, die seine Transportkapsel herunterplumpsen lässt und ihm vorerst die Freiheit zurückgibt.
So macht er sich also mit seinem treuen Werkzeug und viel Wut im Bauch auf die Suche nach Jen und Enisi und begegnet zwischendurch immer wieder anderen Menschen, die apathisch in einer Ecke hocken und wirres Zeug labern. Also fast so wie in jeder Großstadt, wenn man mal in den Supermarkt einkaufen geht. Doch für Enisi kommt jede Hilfe zu spät, und Tommy muss mit ansehen, wie er zunächst von mehreren Stahlspitzen durchbohrt und anschließend zu Alienfutter zerkleinert wird. Jetzt ist Tommy richtig missgelaunt und möchte wenigstens noch Jen retten.
Im Prinzip macht man nun nichts anderes, als plündernd und brandschatzend durch die dunklen Gänge der Alien-Sphäre zu latschen und den Body-Count in ungeahnte Dimensionen zu katapultieren.
„Dimensionen“ ist auch ein gutes Stichwort (Mann, bin ich gut): Das im Vorfeld wohl am meisten diskutierte Feature von Prey sind ja die Portale. Betritt man einen solchen Durchgang, kann es passieren, dass man plötzlich aus der Decke des neuen Raumes fällt und sich blitzschnell orientieren muss. Leider haben die Entwickler längst noch nicht alle Spielereien umgesetzt, die damit möglich wären. Normalerweise läuft es nur darauf hinaus, dass plötzlich auftauchende Portale eine Art Erklärung für spawnende Gegner sind, die einem unverhofft entgegenstolpern. Und ob ich einen Raum nun durch ein Portal oder eine altmodische Tür betrete, ist mir eigentlich herzlich egal.
Ein weiteres Feature sind Wall-Walk-Pfade, das sind weißlich-glühende Schienen an den Wänden und der Decke, an denen sich die Schuhe von Tommy festsaugen und er folglich die Wände hochgehen kann. Das sorgt oftmals für erheiternde Gefechte, wenn man sich kopfüber mit Aliens balgt, die nach ihrem Ableben scheinbar nach oben fallen oder sowieso schon seitlich an einer Wand kleben. Eine Warnung allerdings noch für Leute, die bereits bei den Alien-Abschnitten von Aliens vs. Predator mit vollem Mund vor dem Rechner saßen: Eine Kotztüte ist leider nicht im Lieferumfang enthalten. Hier hätte sich sicherlich ein guter Ansatzpunkt für Goodies in der Packung ergeben. Na ja, vielleicht im Nachfolger.
Um sich die garstigen Monster vom Leib zu halten, greift Tommy auf ein optisch etwas verstörendes, in der Wirkung aber erstaunlich irdisches Waffenarsenal zurück. Die erste Waffe ist im primären Modus ein leichtes Maschinengewehr, im Sekundärmodus ein waschechtes Scharfschützengewehr, dessen Zielvorrichtung sich an seinem Auge festklebt und Gegner farblich hervorhebt. Weiter geht es mit Weltkraumkrustentieren, die auf das Ausreißen eines Beinchens höchst explosiv reagieren und sich dementsprechend gut als Handgranate missbrauchen lassen. Es folgen noch eine Art Säureschrotflinte, ein ultra-schnelles Maschinengewehr mit Granatwerfer und ein Raketenwerfer, der natürlich nicht fehlen darf. Hier sieht man wieder, wie durchdacht und aus einem Guss die Welt von Prey wirkt: Weltraumkrabben sind explosiv? Also was liegt da näher sie in eine Membranhülle zu packen und den Feinden entgegenzufeuern? Auf diesem Prinzip basiert nämlich der Raketenwerfer. Mit Abstand am interessantesten ist aber die Leech Gun: Dieses exotische Gerät kann mit einer von vier Ladungen gefüllt werden und ändert auch jedes Mal seine Wirkung. An überall in den Levels herumhängenden Ladestationen kann man zwischen rotem Plasma (schnell feuernde Plasmakanone), Eis (Freezer-Gun, bekannt aus Duke Nukem), Blitz (Railgun) und Feuer (unglaublich starker und permanenter Feuerstrahl, der Gegner fast augenblicklich vernichtet und den Spieler beim Feuern rückwärts drückt) wechseln.
Eine Waffe, der Spirit Bow, steht einem nur in der Geisterwelt zur Verfügung, die Tommy ab einem sehr frühen Punkt im Spiel betreten kann und auch öfters muss. Sein toter Großvater lebt nämlich in der Geisterwelt der Cherokee weiter und unterstützt von dort aus seinen Enkel mit allerlei spirituellem Gesülze und Fähigkeiten. An einigen Stellen – meist mit einem Sonnensymbol gekennzeichnet – muss Tommy in den Spirit Walk wechseln, lässt damit seinen physischen Körper ungeschützt zurück und wandelt als fast unsichtbarer Geist durch die Welt, der Kraftfelder mühelos durchschreiten und auch deaktivieren kann. Neben der Lebensenergie gibt es deshalb eine Mana-Anzeige, die gleichzeitig Leben und Munition für den Bogen darstellt.
Sollte Tommy sterben, was aufgrund des sehr humanen Schwierigkeitsgrades nicht allzu oft passieren dürfte, erscheint kein blinkendes „Game Over“ auf dem Monitor, sondern er landet in einer Geisterweltarena (tolles Wort) und schießt mit seinem Bogen rote (Lebensenergie) und blaue (richtig, Mana) Flugwesen ab, während sein Körper sich langsam dem Boden nähert. Sobald dies geschehen ist, taucht Tommy quicklebendig an der Stelle auf, wo er gestorben ist und kann den Kampf fortsetzen. An sich keine schlechte Idee, bleibt doch der Spielfluss erhalten und man muss nicht ständig daran denken, auf die Quicksave-Taste zu hämmern. Es gibt bloß zwei Haken: 1. wird selbst so etwas Originelles wie der Death Walk irgendwann todlangweilig (ha, schon wieder ein Brüller…) und 2. gewinnt man Gefechte damit nicht durch Können, sondern durch Penetranz.
Was für Andere Lassie, Flipper und Fury sind, ist für Tommy sein Falke Talon, der eigentlich schon so lange tot ist, dass er nicht einmal mehr stinkt. Dennoch fristet er ein ebenso schlichtes wie klischeehaftes Dasein in der berühmt-berüchtigten Geisterwelt, in der auch Tommys Großvater sein spirituelles Unwesen treibt.
Nach dessen erster Stippvisite in der wunderbar-naiven Parallelwelt seiner Urahnen folgt Talon seinem Herrchen treudoof durchs Raumschiff. Zwar rettet er keine Kinder vorm Ertrinken, bindet auch keine Seile an Bäume und holt nicht den Dorfsheriff zu Hilfe, dafür flattert er hektisch auf Gegner drauf zu und lenkt diese ab. Außerdem scheint er einen Sprachkurs in Sachen Alienisch (ich weiß… schlechter Witz) belegt zu haben, denn allein durch seine bloße Anwesenheit auf Monitoren übersetzt er deren Schriftzeichen und Zahlen.
Grafisch lässt sich Prey nichts zu Schulden kommen. Die Doom 3-Engine sorgt für einen düsteren, metallischen Look, dem es perfekt gelingt die SciFi-Atmosphäre herüberzubringen. Auf den Gebrauch von Hektolitern an Klarlack wie im Engine-Vorbild haben die Entwickler glücklicherweise verzichtet. So richtig abwechslungsreich ist die Optik leider nicht, was allerdings auf die Wahl des Schauplatzes zurückzuführen ist. Die Leveldesigner geben sich zwar sichtlich Mühe einfallsreiche Umgebungen zu schaffen, dennoch herrscht spätestens nach dem zweiten Drittel visuelle Monotonie, die nur sporadisch von imposanten Effekten unterbrochen wird.
Positiv zu vermerken ist die tadellose Performance des weiterentwickelten Grafikmotors, der das Spiel pfeilschnell über den Monitor rennen lässt und dabei dennoch deutlich mehr Details darstellt als die Konkurrenz von id Software und Raven Software.
Was hebt Prey nun über Shooter XY? Das ist schwer zu beschreiben. Wäre ich bösartig, könnte ich einfach behaupten, dass Prey ein Potpourri aus etwas Doom 3 (schleimige Alien-Umgebung), einer großen Portion Quake 4 (Menschen werden entführt u. mit Maschinen verschmolzen) und einer Prise Half-Life 2 (mutierte Menschen in der Zitadelle u. Fahrt in der Kapsel) wäre.
Grundsätzlich macht man das ganze Spiel über nichts weiter als Rumlaufen, Ballern, Ballern, ein Mini-Rätsel mit Hilfe des Spirit Walk lösen, Ballern, mit einem Alienraumschiff herumdüsen, Ballern, Mini-Rätsel, Ballern, etc. Also nichts wirklich Weltbewegendes.
Das Besondere ist die Individualität von Prey, die sich trotz des spärlichen Ideenreichtums durchsetzt und dem Spiel eine erstaunliche Originalität verleiht. Es ist die Art, wie die Geschichte, die später tatsächlich über das übliche Einerlei hinausgeht, präsentiert wird, die Strukturierung von Action-, Rätsel- und Flugszenen und natürlich der faszinierende Widerspruch aus Fiktion und Glaubwürdigkeit.
Auf der einen Seite ein Indianer, der seine Freundin aus den Klauen boshafter Außerirdischer befreien möchte und, ambivalent, die ewige Sehnsucht der Menschheit nach der Ursprünglichkeit, ja, der widersprüchliche Zwiespalt zwischen unaufhaltsamem Fortschritt und der ersehnten naiven Rückständigkeit.
Bezeichnenderweise sind es nicht die diversen Waffen, die Tommy letztendlich den Sieg einbringen, sondern der Glaube und die Akzeptanz seiner Herkunft und Kultur.
Anerkennung verdient das Finale, ungeachtet des zugegebenermaßen nur bedingt spannenden Endkampfes. In einer Zeit, in der immer mehr Spiele in Episodenform und/oder mit einem satten Cliffhanger am Ende daherkommen, ist der Ausgang von Prey wohltuend befriedigend und doch faszinierend zugleich, und ganz nebenbei (Credits abwarten) hält man sich clever weitere Optionen für einen zweiten Teil (mein Vorschlag: Prey 2 – Wo zum Henker ist Talon?) offen, ohne, dass sich die Spieler gepflegt verarscht vorkommen. Man merkt förmlich, wie unzufrieden die Entwickler mit dem Ausklang einiger Konkurrenzprodukte gewesen sind und haben es bei ihrem Titel entsprechend besser gelöst.
Ach ja, zwei Sachen noch vor meinem Schluss: Der Spaß war nach ziemlich genau sechs Stunden und zehn Minuten bereits vorüber. Das mag für einen Vollpreistitel als sehr wenig erscheinen, dennoch habe ich in so ziemlich jeder Minute eine Mordsgaudi gehabt, und die Spielzeit hätte ich subjektiv erheblich länger eingeschätzt.
Wer noch einen alternativen Anfang sehen möchte, sollte sich diesen Film zu Gemüte führen, der mit The Movies realisiert wurde.


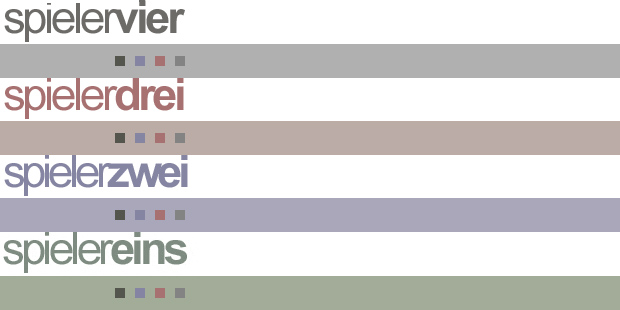








Neueste Kommentare