2015 habe ich voller Ehrfurcht einen Text darüber verfasst, wie mich das damals neu erschienene N++ in die Knie gezwungen hat. Heute möchte ich dieses Lob auf Splinter Zone ausweiten. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß daran, zu versagen. Das möchte ich vor allem dem schnellen Spielgefühl zuschreiben – und den tollen Explosions-Partikeleffekten.
Splinter Zone ist das Projekt eines einzelnen deutschen Entwicklers, Eric Merz alias MOKKOGRAD. Die Entwicklung des Spiels ließ sich quasi seit Beginn öffentlich mitverfolgen, die explosionslastigen GIFs auf Twitter ließen wenig Zweifel am Megaman-Erbe des Spiels.
Spiele mit Megaman-DNA üben eine seltsame Anziehung auf mich aus. Obwohl ich nur das allererste je selbst durchgespielt habe – auf einem graphischen Taschenrechner in der großen Pause, meist – mag ich vor allem das Konzept von Männchen mit Wumme gegen zu viele, zu starke Gegner in 2D. Splinter Zone trifft damit einen Nerv, der schon seit einer Weile nicht mehr bedient wurde; nein, Mighty Number irgendwas, du existierst nicht.
Splinter konzentriert sich so stark auf das nötigste, dass es genauso gut auch auf einem GameBoy gespielt werden könnte. Die Standardbildschirmeinstellungen skalieren es sogar auf die ungefähre Bildschirmgröße von Nintendos grauem Ziegel. Mein Highscore-Gen flüstert mir auch stetig zu, dass es klug wäre, so zu spielen – wie jeder Shooter-Zugeneigte weiß, lassen sich Gefahren an den Bildschirmrändern bei kleiner Anzeige viel besser erkennen. Aber Splinter Zone macht so schön bumm, ich kann nicht anders, als es auf riesig zu schalten und dann gnadenlos zu Klump geballert zu werden. Denn Splinter ist schwer, ganz das Roguelike, und bewirft mich mit schießenden, schleudernden und springenden Gegnern, die in ihrer Knuffigkeit fast aus Cave Story stammen könnten, da aber nicht so tödlich gewesen wären. Bis zum ersten Boss schaffe ich es hin und wieder mal; darüber hinaus nie, und wenn ich vorher sterbe, wundert mich das auch nicht wirklich.
Trotzdem bin ich dem Spiel nie böse. Die Steuerung ist tight, wie der Amerikaner sagen würde, und absolut simpel zu verstehen; wenn ich aufs Maul kriege, habe ich versagt, nicht das Spiel. Der Neustart, ebenfalls typisch Roguelike, geht schnell und ohne langes Laden vonstatten, sodass sich mein Sid Meier-gestählter Nur Noch Eine RundeTM-Instinkt bestens angesprochen fühlt. Grafisch ist das Ding kein Durchbruch – muss es aber auch nicht, denn Merz wusste, worauf es beim Sidescroll-Ballern ankommt: Auf beeindruckend explodierende Gegner. Das Trefferfeedback ist so befriedigend, dass ich selbst der niemals endenden Wiederholung des ersten Gebiets nicht müde werde. Denn trotz prozeduraler Erzeugung scheine ich meist die gleichen zwei Kurse zu bekommen, ob absichtlich oder nicht vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht sind die abwechslungsreicheren Sprungpassagen auch noch schwerer und werden weniger miserable Spieler weiter hinten serviert.
Vermutlich werde ich die niemals sehen; dabei hat der Entwickler auch an Luschen wie mich gedacht und jede Menge Cheatcodes direkt ins Startmenü eingebaut. Zu schlecht? Dann schalte doch einfach alle Gegner aus oder mach dich unverwundbar. Aber das würde mir den Spaß nehmen, mich vom ureigenen Konzept eines solchen Shooters abkapseln. Dass der Schwierigkeitsgrad eines Spiels nichts mit seiner Wirkung oder seiner Narration zu tun hat, würden manche sagen. Da widerspreche ich. Ein durch Unachtsamkeit induziertes Scheitern kann in Dark Souls die Verzweiflung, auf der die Spielwelt aufgebaut ist, besser vermitteln als diverse Itembeschreibungen. Genauso kann skillbasierte Action in einem Shooter oder anderweitig auf Herausforderung ausgelegtem Spiel das Gefühl tragen, das Spiel vollendet, ja, bezwungen zu haben. Sicher schmälert es die erzählte Geschichte (von der Splinter Zone meines Wissens nach keine hat) nicht, wenn man sie auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad erlebt. Aber das Besondere am Medium Videospiel ist eben, dass die Erzählung nicht nur aus dem Erzählten besteht; ich behaupte sogar, zwingend nicht nur daraus bestehen kann. Selbst in Everybody‘s Gone to the Rapture ist es integraler Bestandteil der Geschichte, dass man sie selbst abläuft, dass man sie im Schritttempo und in der Reihenfolge der eigenen Erkundung erlebt. Das Spiel mit einem Zeitraffer zu versehen würde das Erlebte beträchtlich schmälern. Spiele müssen nicht leichter werden; sie müssen besser darin werden, sich zu erklären, dem Spieler mehr Zeit lassen, sie zu meistern, bevor sie ihn stark fordern. Alles andere ist der leichte Ausweg, und der ist selten erfolgreich.
In diesem Sinne:
Nein, Splinter Zone, ich schalte mich nicht unbesiegbar. Vielleicht sehe ich die Credits so nie, aber ich kann zumindest anhand meiner eigenen Fähigkeiten entscheiden, wann ich weit genug gekommen bin, um genug von deiner steilen Schwierigkeitskurve und deinen wunderbaren Partikeleffekten zu haben.





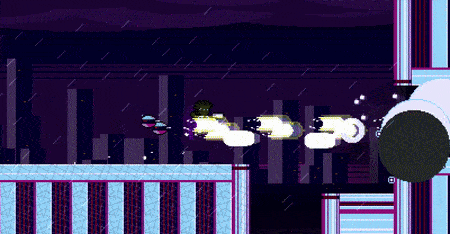










1 Kommentar