Am Ende wurde dann doch noch alles gut: Persona 5 und ich sind so ein wenig wie eine von Klischees triefende Rom-Com: Rosaroter Start, bitterer Tiefschlag, zuletzt aber alles Liebe. Definitiv nicht die meines Lebens, aber auch kein Spiel für eine Nacht. Aber der Reihe nach.
Alles, was ich von der Reihe bislang kannte, waren Scherze wegen dem immer mal wieder nach hinten verschobenen Veröffentlichungstermin des fünften Teils. Die Umsetzung des vierten Teils für die Playstation Vita war ein Begriff, mehr als das aber auch nicht. Das brachte das Glück mit sich, unvoreingenommen an die Sache zu gehen, fast zumindest, denn letztlich war es der Hype bei Twitter, der mich neugierig gemacht hat. Da hier oftmals mehr gelobt wird, als die Realität hergibt (Hi, Star Wars!), wollte ich mir das selbst anschauen.
Vielleicht hätte ich damit etwas warten sollen, denn Persona 5 hat den denkbar schlechtesten Start erwischt: Es war das erste Spiel, das ich nach Zelda: Breath of the Wild (diesen Podcast dazu wollt ihr hören) und dem DLC zu Dark Souls 3 startete. Beides Spiele, die durch ihre Offenheit punkten, erstgenanntes definiert den Begriff Open-World meiner Ansicht nach sogar neu. Und dann Persona 5 mit einem stundenlangen Tutorial, das schlauchartiger nicht sein könnte. Natürlich kann man die genannten Spiele nicht vergleichen, angefühlt hat es sich dennoch wie ein Kulturschock – von 100 Prozent Freiheit auf „Drücke X, nächster Dialog, drücke X, Cutscene, usw.“.
Rückblickend ist klar, warum das so sein muss: Persona 5 punktet mit einer äußerst komplexen Story, die auf gleich drei Ebenen stattfindet. In der Gegenwart ist unser Held verhaftet, weil er einer mysteriösen Organisation angehört, die offenbar Menschen manipuliert. Wie es dazu kam, das erzählt er – hier steigen wir ein. Und dann ist da noch die letzte Ebene, eine Art Parallelwelt, in der sich die Abgründe menschlicher Gedanken zu finsteren Wesen manifestieren. Die bekämpfen wir, traditionell rundenbasiert mit RPG-Elementen wie Charakter aufleveln, Ausrüstung sammeln, Items craften, neue Angriffe lernen, Party im Auge behalten.
Bis wir den ersten Kampf jedoch überhaupt sehen, vergeht jede Menge Zeit: Erst mal lernen wir den namenlosen Helden kennen, der offenbar von der Schule flog, weil er ein Gewaltverbrechen verhinderte. Blöd nur, dass der Gegner bestens vernetzt zu Polizei und Politik war und die Sache anders darstellte. Ergebnis: Neue Schule, lästernde Mitschüler, alles scheiße. Obendrauf ein Sportlehrer, der den Laden offenbar tyrannisiert. Sagt uns zumindest der erste Freund, den wir kennen lernen. Was es damit auf sich hat, wie wir in die Gedankenwelt dieses Lehrers vordringen, ihn letztlich bezwingen, das wird die kommenden zehn Spielstunden bestimmen.
In deren Verlauf geht es mitnichten nur um Kämpfe in der Schattenwelt, dargestellt als Schloss, das es zu erstürmen gilt. Vielmehr findet Persona 5 in der Gegenwart statt, wo es gilt, den Held durch seinen Schulalltag in Tokio zu begleiten. Dazu gehören schnöde Aufgaben wie lernen, sich einen Job suchen, im Cafe des Typen aushelfen, der ihn nach dem Schul- und damit auch Ortswechsel aufnahm. Oder Freunde treffen – die Typen, die einen bei den Streifzügen in die Dungeons begleiten. Viele der Aktionen stärken nämlich den Charakter des Helden, andere wiederum seine Verbindung zu den Verbündeten. Womit man seine Zeit verbringt, entscheidet man selbst – sicher ist nur, dass sie vergeht, man also nicht ewig viel davon hat und sich entsprechend überlegen muss, womit man sie sinnvoll zubringt. Dieser Umstand kann bisweilen ein wenig stressen, schließlich will man es ja allen recht machen. Lässt man sich jedoch drauf ein, versinkt man in einer Art Alltags-Simulation, die durchaus reizvoll ist und zahllose Herausforderungen bietet (die DVDs etwa, die ich ausgeliehen hab, sind seit zwei Wochen überfällig. Hatte keine Zeit dafür, waren Examensprüfungen, außerdem ging ich lieber mit meinem Kumpel joggen).
Stichwort Zeit: Wer einen Palast stürmen will, hat ebenfalls nicht ewig viel davon. Grade mal 14 Tage sind es beim ersten. Zunächst denkt man sich „Jo, passt doch locker“, ist man jedoch erst mal drin, fällt zügig auf, wie knackig der Schwierigkeitsgrad ausgefallen ist. Gegner haben spezielle Schwachpunkte, die man rausfinden muss. Das Kampfsystem ist komplex und bietet von „Erledigt das automatisch“ bis „Ich steuere jede Bewegung meiner Party“ zig Optionen: Spezialattacken, Heilung, Angriff mit Nahkampfwaffe, Angriff mit Schusswaffe, in Deckung gehen, Feind analysieren, und und und. Vor allem muss man seine „Persona“, also den Begleiter, der für einen kämpft, weise auswählen. Unser namenloser Held kann gleich mehrere davon mit sich herumtragen, sie alle haben einzigartige Fähigkeiten und steigen nach gewonnenen Kämpfen auf. Als wäre das noch nicht komplex genug, kann man zwei davon übrigens zu einer neuen Persona verschmelzen. Wer (wie ich) nie mit der Serie zu tun hatte, steht da durchaus erst mal vor einem Berg. Sicher, Ni no kuni war ähnlich, was das Kampfsystem betrifft, wenn auch weniger komplex. Final Fantasy auch, hört man (hab nie einen Teil gespielt). Catherine hatte den Aspekt der Lebens-Simulation ebenso, selbst GTA oder Bully boten deutlich abgespeckt ähnliche Features. Hier hat man bei all dem einfach eine dicke Schippe draufgelegt. Und das kann verwirren.
So kam’s auch, dass sich gegen Ende des ersten Palastes der Frust ein wenig Bann brach: Savepoints sind rar, die Spielmechanik noch nicht ganz verinnerlicht und von den eingangs lässigen 14 Tagen, die zum Erobern zur Verfügung standen, nur noch 7 über. Wieso? Weil ich immer wieder aus der Parallelwelt musste, um die Charaktere in der echten Welt zu stärken, etwa durch den Erwerb neuer Ausrüstung oder den Kauf von Heil-Items. Richtig genervt hat dann, dass ich zwei Mal eine ganze Menge Fortschritt verlor, was in dem Fall bedeutet, vom letzten Speicherpunkt inklusive aller Gegner nochmal loszulegen. Sollte den erprobten Souls-Spieler nun nicht frustrieren, mag man denken. Hat es aber, vielleicht auch, weil ich mich abseits der Schattenwelt im Leben meines Helden gerne freier bewegt hätte. Geht aber nicht, noch nicht. Erst mit der Zeit bekommt man hier Vorteile wie etwa die Erlaubnis, auch Nachts das Haus verlassen zu dürfen. Selbst dann ist Persona 5 jedoch nicht so „offen“ wie andere Spiele, in denen wir das Leben eines Helden zeichnen. So lange man nicht lernt, wie man dieses Spielchen mitspielt und dass diese Mechanik einfach ganz andere Herausforderungen als eine völlig offene Welt mit sich bringt, hat man wenig Spaß dran.
Letztlich hab ich es dann gelernt – und dann sprang der Funke auch über. Denn Persona 5 ist über alle Maßen stylisch gestaltet, der J-Pop-Soundtrack ganz zuckersüß-schrecklich ohrwurmig, das Design der Charaktere Klasse und die Dialoge ohnehin. Es ist komplex, ja. Und Spieler (mich nicht ausgenommen) heutzutage an einfache, schnell zugängliche Titel gewohnt, die ohne große Umwege gleich von der Leine lassen – dafür aber oft nicht mehr bieten als gewohnte Kost. Hier musste ich nochmal was Neues lernen und das hat sich rückblickend gelohnt. Wobei „rückblickend“ etwas falsch gewählt ist – ich bin bei weitem noch nicht durch. Im Gegenteil: Vermutlich hab ich nicht mal ein Viertel des Spiels gesehen, wenn überhaupt. Mehr braucht’s aber auch nicht um festzuhalten, dass Persona 5 ein Titel ist, der aus der Masse heraussticht und das im positiven Sinn. Es wird wie eingangs erwähnt nicht die Liebe meines Lebens – aber für die kommenden 50 bis 60 Stunden sicher noch eine angenehme Begleitung, die ich nicht missen möchte.




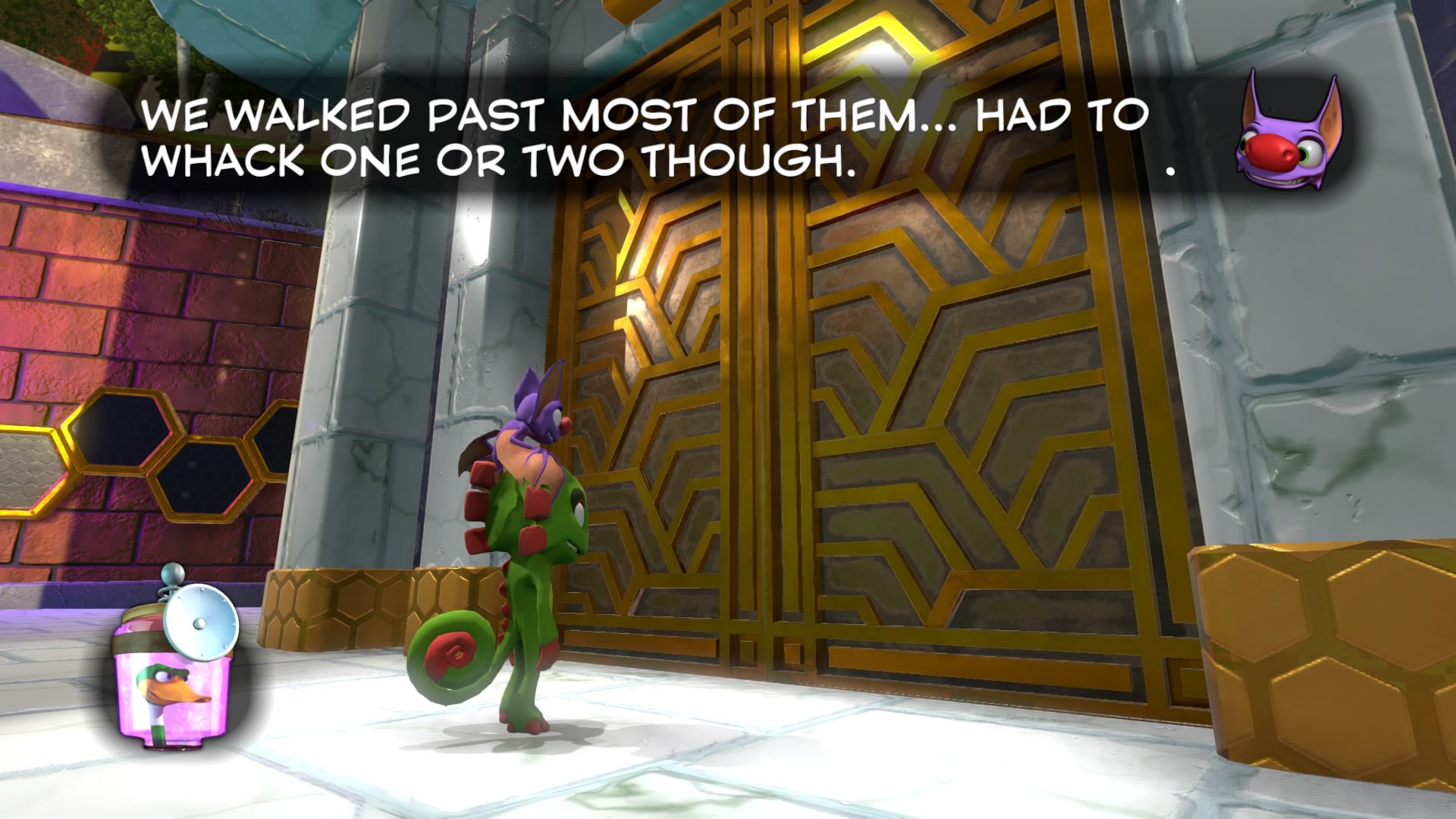









2 Kommentare
Ich erkenne mich in dem Text ein bisschen wieder, wie ich damals mein erstes Persona (4) gespielt habe. Deshalb glaube ich, dass ich es super toll finden würde, würde ich eine PS4 besitzen. Allerdings klingt es dann wieder schon so gleich, dass ich keinen Grund sehe, noch ein Persona zu kaufen/spielen und es damit keinen Grund gibt, eine PS4 zu erwerben, wo doch ein Persona genau der Systemseller (für mich) sein sollte. … Das, und knapp 200 Stunden Tokyo Mirage Sessions #FE.