Ich liebe Pokémon Go, aber spielen will ich es nicht. Die Faszination dahinter erkenne ich mit einem lachenden Auge und eines, das hundejault im Angesicht von ein paar hundert Megabyte Datenvolumen im Monat. Ganz abgesehen von der Spielmechanik, die mir persönlich nichts gibt außer Laufkilometer. Wie dieser fast schon beängstigende Hype von 2016 allerdings Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft auf die Straße holte, war das Schönste, was ich seit langem erleben durfte.
Es klingt so banal wie die Teletextseite 666: Die Welt ist böse. Wenn sie das mal nicht ist, wuchtet sie dir die Last aller luziferischen Untaten auf die Schultern, die du und nur du allein tragen musst. Schaut man in die Nachrichten, dominieren Themen, die das Magengeschwür wuchern lassen. Flüchtlingsdebatten hier, Donald Trump da, achherrje, die Briten, die dürfen wir ja auch nicht vergessen, und wo wir schon bei England sind: Das Wetter denkt ja auch nur an sich und das bedeutet nach einem Blick aus dem Fenster: ganz düsterer Egoismus.
Somit war Pokémon Go genau das, was viele brauchten: eine Pause, eine kleine Unbeschwertheit in Zeiten von Rassismus, Homophobie und Wirtschaftskrisen. Schnell war Pokémon Go die Steuersenkung, gar das „Mega!“ unter den Videospielen. Wer nicht lobsang, nickte zumindest anerkennend. Es dauerte, bis die Sause nicht mehr so wummerte. Staatspräsidenten legten das Handy weg, die Polizei konzentrierte sich wieder auf die Verbrecherjagd, Social-Media-Manager kümmerten sich weiter um das Entfernen von Hasskommentaren. Das Gefeiere endete nie komplett, betraf irgendwann aber nur noch die, die mit Videospielen mehr am Hut hatten als eine kleine Erinnerung.
In Pokémon Go fand man genau das, was man schon seit Jahrzehnten in dieser Marke findet: eine unbeschwerte Flucht. Ob Edition Blau, Schwarz, Saphir oder Silber, egal vor wie vielen Jahren die Spiele erschienen, keines davon alterte, denn das grundlegende Konzept ist frei von Konventionen und vor allem: Vorurteilen. Als Junge oder Mädchen tritt der Spieler hinaus in eine unbekannte Welt, verläuft sich in hohen Gräsern, bis das Wilde – also ein Pikachu, ein Relaxo, ein Taubsi — in der Tasche landet. Für alle Zielgruppen geeignet und sogar von allen genutzt, blieb Nintendo stets bei der bekannten Formel. Kämpfe wurden dynamischer, die Grafik ein bisschen besser, aber die ersten Pokémon-Editionen Blau und Rot sind längst nicht nur Klassiker, sondern können problemlos auch mit den aktuellen Titeln mithalten.
Der Grund ist simpel: Im Kern sind die Editionen alle gleich und das gilt auch für die Spieler. Fingen sie damals an, sind sie heute längst Erwachsene mit Eigenheim und Lebensversicherung. Mit Pokémon flüchteten sie in eine Welt, in der alles so kompliziert erschien, du auf dich allein gestellt warst, aber mit der Zeit tausend Dinge gelernt hast. Du hast acht Orden gewonnen, weil du trainiertest. Du hast die Top 4 besiegt, weil du gemerkt hast, dass Geist-Pokémon die heftigsten Player sind. Du hast vibriert vor Freude, als du dein Sonderbonbon mit Hilfe von Missingno vervielfachtest. Zuweilen war es knifflig, nie aber unmöglich.
Selbst nach einer Niederlage gegen den Erzrivalen oder Team Rocket war ein Aufstehen allein deshalb so leicht, weil einerseits bereits im Kampf eine neue Strategie im Kopf entstand, andererseits nie etwas wirklich Dramatisches geschah. Die Pokémon sterben nicht. Verwundet, ja, auch schwer, aber der Tod spielte selten eine Rolle, eher noch die Frage um die zuweilen zweifelhafte Zusammenarbeit von Mensch und Pokémon. Oft lud man den Spielstand neu, wenn es mal nicht so klappte wie gedacht, doch vergaß man das Speichern und erwachte im Center, war der Elan groß, vielleicht war es sogar ein zorniger Elan, weil die Vorstellung von einem verletzten Glurak schmerzte, schließlich ist der Spieler für sie verantwortlich. Dafür zu sorgen, dass ihnen nichts geschieht, also: die Lebenspunkte nicht auf null sinken, das ist das Wichtigste.
Und so wickelte sich auch das emotionale Band um fast jedes dieser Viecher, damit sie bloß nicht entschlüpfen. Wie sehr mein Herz pochte, wenn ich ein stundenlang trainiertes Pokémon gegen ein anderes tauschte, weil es besser in meinen nächsten Kampf passte! Ich wehrte mich sogar gegen das wesentliche Spielprinzip: Ich konzentrierte mich meist auf 15, vielleicht 20 Pokémon und wenn ich glaubte, mein Team sei auf das Kommende vorbereitet, ließ ich die Pokébälle in der Tasche; ja tatsächlich, zumindest im ersten Durchgang einer neuen Edition besaß ich fast nie mehr als 30 Pokémon. In einem Spiel, das die Sammelwut explizit auch zum Motto einer ganzen Marke hervorhebt (“Schnapp sie dir alle!”) – ist das natürlich ein bisschen absurd.
Aber es schmerzte zu sehr, wenn ich an all jene dachte, die auf meinem In-Game-Computer Däumchen drehten oder fettleibig wurden. Zwar sehe ich sie meist nur, wenn ich kämpfe, aber ich stelle mir auch immer vor, wie sie mit mir umherirren, tollen, spielen, wenn ich sie mit mir führe. Ein reines Werkzeug für die Spielmechanik sind sie nie, im Gegenteil; anderswo ist das Ballern, Kommandieren oder Rätseln selten mit Gefühlen verbunden, es passiert einfach, diese Interaktivität; man fiebert erst mit, wenn die kleinen Zwischensequenzen irgendwas auf ein Podest heben oder von dem Podest fallen lassen. Die Taschenmonster hingegen behandelt man mit Respekt, vermutlich deshalb, weil die meisten Spieler dank Sammelkarten, Filme und Serien ein recht lebendiges Verhältnis zu ihnen haben.
Pokémon Go ist da ähnlich simpel: Besonders die Exemplare aus den ersten Editionen, die auch heute noch von Jugendlichen nachgeholt werden, sind hier und dort und überall zu finden, auf Friedhöfen, in Polizeirevieren, Krankenhäusern, Vorgärten, Parks oder mitten auf der Straße. Nun aber findet die Flucht in eine digitale Welt ganz real statt, denn niemand mehr sitzt zuhause und startet den Nintendo DS oder den Gameboy Color, sondern flitzt durch Dorf und Großstadt mit dem Smartphone vor den Augen. Nie war man näher dran, selbst Pokémon-Trainer zu sein. Ein Kindheitswunsch, der später zum Erwachsenenwunsch wurde, ist nun Wirklichkeit.
Auf einer anderen Ebene fasziniert Pokémon Go allein durch das Sammeln. Wer gar nicht so sehr an hochgestochenen Gedankenspielen rund um Jugend und Flucht interessiert ist, bricht das Konzept herunter und fängt wie ein Bekloppter ein Exemplar nach dem anderen. Im mobilen Ableger sind die Kämpfe zwar nicht annähernd so komplex wie die rundenbasierten Getümmel in den großen Spielen, doch reicht es für ein derartiges Spielprinzip. Wer ein seltenes Pokémon fängt, ist ohnehin glücklich.
Vielleicht beschreibt es das am besten: Pokémon beglückt, hat es schon immer, wird es auch immer. Die Go-Variante machte das deutlicher denn je. Man sah es an den Downloadzahlen der App, an den Medien, die Themenfremden das Konzept erklärten, an den absurd vielen News in der Videospielpresse, die sich mehr denn je an Headline-„Journalismus“ ergötzten. So einen Hype hat man zuletzt erlebt, als, nun, keine Ahnung. War es der Harlem Shake oder die Ice Bucket Challenge? Gefühlt hat Pokémon Go auch die schon nach wenigen Tagen überflügelt, nicht zuletzt zu sehen an den Massen, die vorbei an den Clickbait-Postings besonnen durch die Straßen schlenderten.
Wie lange das noch andauert und wieso plötzlich alle Dämme zu brechen scheinen, was sowohl das Erleben als auch die Berichterstattung über Videospielen angeht – damals blieb es fraglich, doch: Es war schlicht wunderschön. Für mich hat dieses Empfinden trotz Fernbleiben des Spiels auf meinem Handy einen persönlichen Grund, nämlich: Ingress. Dieses Augmented-Reality-Game stammt von Niantic Labs, die ebenfalls Pokémon Go entwickelten. Das Konzept funktioniert ähnlich: Mehrere Fraktionen nehmen Portale ein, die in Städten und Landschaften verstreut sind. Auch das habe ich nie ausprobiert, aber jemand, der mir nahestand, war vernarrt darin: mein Onkel, der vor zwei Jahren verstarb.
Ich bin mit Videospielen aufgewachsen, doch dauerte es ewig, bis ich Ingress verstand. Ein Videospiel musste meinem Verständnis nach der Grafik wegen blitzen und blenden; eine Spielmechanik sollte komplex sein, schwer zu meistern; Geschichten und Charaktere überflügeln Filme ohnehin, dachte ich; alles in allem festigte ich ein trauriges Bild von dieser Pixelkunst, die sehr viel mehr sein kann als das. Ingress veränderte meine Denke nachhaltig – und wenn ich das sage, meine ich damit meinen Onkel, der im Auto, bei einer Familienfeier oder beim Einkaufen das nächste Portal hackte, einnahm oder einfach auf das Handy starrte.
Eine Zeit lang traf ich auf meinen Onkel immer mit dem einen Thema, das unsere Gespräche beherrschte: Ingress. Manchmal war das Wiedersehen nach einigen Wochen beschränkt auf ein kurzes Aufschauen und Kopfnicken, weil er vermutlich versuchte zu ersinnen, wie er an das drei Kilometer entfernte Portal kommt, ohne zu lang der Feier fernzubleiben. Manchmal schlug er Spaziergänge vor. Wir wussten alle, warum. Familiäres Beisammensein, gestärkt durch ein Videospiel, angeführt von meinem Onkel.
Meine Affinität zu Pixeln ist in meiner Familie unerreicht, allerdings schaffte er es nie, mich für dieses Spiel zu begeistern. Aber vielleicht verstand ich mehr als die anderen diesen unkontrollierten Spaß, den Ingress auslöste; unkontrolliert, weil der Konsum plötzlich nicht mehr im stillen Kämmerlein, sondern in aller Öffentlichkeit stattfand, ja sogar ausnahmslos nur so funktionierte. Dass er jetzt fort müsse, denn da hinten sei ein Portal, so etwas hörte man oft und es gefiel nicht jedem, sein Gehen führte zu Kopfschütteln und das Kopfschütteln zu einem Lächeln – so ist er nun mal, hieß es dann immer. Ich hingegen dachte stets von Anfang an: Mach sie fertig.
Und das tat er dann auch. Mit einer unüberwindbaren Euphorie tingelte, eroberte, spielte er. Sowohl beruflich als auch privat begleiten mich Videospiele seit Jahren, nie zuvor jedoch erlebte ich eine so unbeschwerte Vernarrtheit. Dass nicht viel mehr Menschen der Faszination erliegen, die in der Zusammenkunft von Pixelwelt und Reallife stecken, blieb mir stets ein Rätsel. Mit Pokémon Go änderte sich alles.
Wohin man blickte, nach links, rechts, geradeaus, auf den Fernseher, das Radio, den Computerbildschirm, auf die Müllverbrennungsanlage oder den Hubschrauberlandeplatz, tagelang konfrontierte uns jeder Sender, jeder Ort, jedes Medium mit dieser App. Abschotten? Höchstens in Schweden, irgendwo im Wald, klappte aber auch nur, bis ein wildes Pikachu erschien. Bis ans Ende der Stadt, bis ans Ende aller weltlichen Aufzeichnungen und noch viel weiter wäre mein Onkel gelaufen. Innerhalb kürzester Zeit lägen ihm die Menschen zu Füßen, damit er ihnen verrät, wie man solchen Eifer aufbringt, wie man solch eine Freude auch dann noch hat, wenn alle anderen einen belächeln.
Ein Blick in die Nachrichten oder nach draußen war für mich also ein stetes Erinnern – an meinen Onkel. In jedem gesenkten, auf das Smartphone gerichtete Gesicht erkannte ich ihn, grinste, weil ich mir sein Lächeln vorgestellt habe, das allzu schnell zu bersten drohte, weil er vor allen anderen ein seltenes Viech gefangen hat. Monate der Trauer vergingen, bis ich nicht mehr sofort weinen musste, wenn ich an ihn dachte, denn dank Pokémon Go konnte ich endlich, endlich, endlich in Erinnerungen schwelgen und lachen, unbeschwert ein bisschen die Gedanken an ihn kreisen lassen, weil unzählige Menschen einfach mal wieder gedankenlos spielten – so, wie er es damals tat, so, wie er mich damals beeindruckte.
Pokémon Go verbindet bis heute. Es war für viele nicht das nächste Spiel, das man auf den Haufen der Benutzten warf, sobald alles bekannt war und dann das Vergessen folgte, weil schon der nächste Titel durch die Konsummaschinerie namens Mensch so rasch wie möglich durchgeschleust werden musste. Pokémon Go ließ euch einfach mal verweilen, ein bisschen staunen und jauchzen und freudenstürmen. Ja okay, eure brutale Beinmuskulatur konnte vermutlich einen Kaugummiautomaten in einen Legostein pressen; ihr allerdings verweiltet mit eurer Motivation, mit eurer Zeit in einem einzigen Kunstwerk. Für den Moment, einen ganz besonders langen Moment hieß es: Genießen, entdecken, erleben, spielen.
Zu Lebzeiten gab mir mein Onkel viel, mehr als mir bewusst war, wie ich nach seinem Tod merkte. Und so verrückt das klingt, so widerlegbar das auch ist, aber fuck, ihr könnt mir das niemals ausreden, weil ich das nach all den verkackten, düsteren Monaten einfach denken wollte: Pokémon Go ist sein Geschenk an uns alle.
Bis heute donnert das Spiel durch die Täler, die Wälder, die Gräben und die Endreihenhäuser, kein Ort ist zu weit oder zu absurd für die Jagd nach Pikachu und Konsorten. Deswegen gilt, gestern wie heute: Spielt, bis die Server ächzen. Spielt, bis ihr sie alle gefangen habt. Spielt, bis ihr plötzlich 15 Kilometer geflitzt seid. Spielt, bis der Akku nach Luft ringt und ihr auch.
Denn ihr alle seid für mich eine Erinnerung an einen ganz besonderen Menschen. Ihr ahnt nicht, wie dankbar ich euch dafür bin.






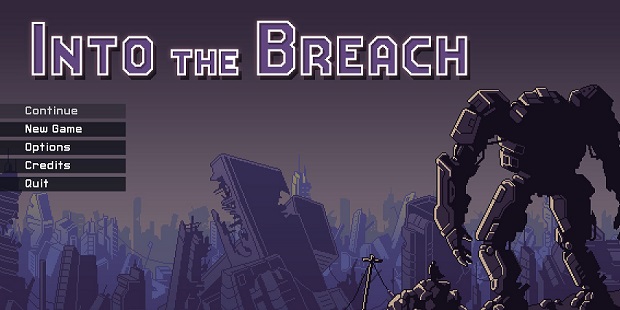









4 Kommentare
Faster Harder Scooter
Als der Pokémon-Go-Hype ausbrach, gab es für mein Mobilgerät No Release. Obwohl (oder gerade weil) ich ein großer Fan der Pokémon-Spiele bin, hat es mich nicht so richtig interessiert. Es war natürlich erstaunlich zu sehen, dass sich Friends plötzlich anstachelten Move Your Ass, sich fragten Where Do We Go? und auf einen Endless Summer hofften, um möglichst viele Taschenmonster schnappen zu können. Aber war es wirklich The Revolution der Smartphone-Spiele? Ich blieb skeptisch, nachdem das Spielprinzip doch sehr überschaubar klang.
Ein paar Wochen gingen ins Land, ich wechselte auf ein Android-Telefon und fragte mich How Much Is The Fish? Also Poké-Mongo geladen und spazieren gegangen. Bald hatte ich die erste Experience und ein paar Monster gesammelt. Don’t Stop dachte ich mir, Don’t Waste No Time und alles en passent erledigen, auch wenn der Ladebildschirm stets Watch Out einhämmerte. Mehr als ein kleiner Zeit- und Batterie-Vertreib ist es allerdings nicht geworden. Die Hysteria konnte ich immer noch nicht nachvollziehen.
Vielleicht liegt es aber auch an Time And Space, denn sitze ich Am Fenster in einem kleinen Ort bei Stuttgart und sehe nur einen einzigen PokéStop im Umkreis von einem Kilometer, der irgendwo mitten in der Pampa ist, macht es gleich noch viel weniger Spaß. Natürlich wurde ich zum Frequent Traveller an diesen Platz, um zumindest ein paar wenige Pokébälle zu bekommen, damit ich die spärlich auftauchenden Pokémon fangen konnte. Expecting More From Ratty – nicht einmal vielen Rattfratz bin ich begegnet. Inzwischen starte ich den Akkufresser kaum noch. Aber manchmal, wenn ich eine Runde mit dem Kinderwagen drehe, denke ich mir, dass ich noch ein paar Kilometer auf die Eieruhren bringen könnte.
Well Done, Peter
Chapeau für diesen Kommentar, Missingno!
(Ich will gar nicht wissen, woher deine Scooter-Fachkenntnisse kommen…)
Dickster Kommentar ever! Wollen wir zusammen auf ein Scooter-Konzert?
Ich hatte noch eine paar (30?) Titel mehr angedacht, darunter ziemlich einfache (Fire) bis fast unmögliche (Aiii shot the DJ). Nur fehlte es an Freizeit um das komplett durchzuziehen und nachdem es ja nur ein Kommentar werden sollte …
Geben Scooter noch Konzerte? (Fast hätte ich gefragt, ob sie noch Musik machen.) Das letzte Mal habe ich H.P. Baxxter in der Jury bei DSDS (oder einer anderen Casting-Show) gesehen.