Bist du das, Gott? Ein Feuerwehrmann beugt sich über meinen Kopf, ja, bestimmt ist er das, der Zottelige höchstpersönlich, und oh Gott, ich bin tot, war dann mein zweiter Gedanke, weil das Auto, das eben noch dastand und nicht fuhr, plötzlich losfuhr und mich auf den Asphalt boxte. Zum Glück rollte ein VW-Bus mit Feuerwehrmännern vorbei, die mich von der Straße auf den Rasen trugen, und leider ist das hier nicht jene Erzählung, wie ich mich nach kurzem Bewusstlosigkeitsschreck in einen Feuerwehrmann verliebte. Vielmehr ist es die Geschichte über das Spiel Lonely Mountains: Downhill und meine Scheißangst vor dem Fahrrad.
Ich liebe Fahrradfahren, genau genommen liebte ich es, das war damals als Kind, als ich ohnehin alles liebte. Gefühlt besaß ich ein dutzend Fahrräder in meinem Leben, aber wie das mit Gefühlen so ist: Sie zerficken deine Wahrnehmung, und deswegen habe ich heute nur noch ein kaputtes Rad und Erinnerungen an ein kaputtes Verhältnis.
Lonely Mountains: Downhill von dem deutschen Indie-Studio Megagon Industries muss also als „Therapie“ herhalten, und für dieses Unterfangen funktioniert es prächtig, denn die einzige Schwäche die es hat: der silbengeschwängerte Name. Lonely Mountains: Downhill, geradeso in einem Atemzug aufsagbar, ist in seinen besten Momenten ein sogenannter Walking-Simulator, nur halt anders. Ganz anders.
Neue Strecken der zu befahrenden Berge schalte ich erst frei, wenn ich gewisse Herausforderungen bewältige, also ein Zeitlimit einhalte oder nicht so oft auf die Fresse fliege, doch beim ersten Erkunden der Strecke legt das Spiel wert auf eben genau das: Erkundung, und deshalb bleibt die Freischaltspirale zunächst geschlossen. Es ist ein vorsichtiges Abtasten der Strecke, und bei einem Spiel, das dem Konzept von Trials sehr nahe kommt, mag das wichtig sein; in der ersten Tuchfühlung zwischen Wald, Wiese und Bergabfahrtshöllenschlund steckt jedoch ein zartes Staunen ob der herbstgüldenen Bäume und der tanzenden Schmetterlinge, und all das wird nur vermittelt durch die bloße, pure Bewegung in der Spielwelt.
Verborgen bleibt den Spielerinnen und Spielern der gesamte Inhalt, sollten sie sich nicht auf die jeweiligen Herausforderungen einlassen. Lonely Mountains: Downhill will Fortschritt durch Fortschritt, indem die geforderten Fähigkeiten mit dem Voranschreiten im Spiel wachsen. So rasant wie die Abfahrt selbst wird das zunehmend komplex. Ein legitimes Spielprinzip – eines, das nicht den prickelnden Funken im Kern von Lonely Mountains wiedergibt. Sobald das erste Befahren einer Strecke beginnt, blockt das Spiel richtigerweise als Vorstufe zum großen (Zeit)Fahren jede vorher auswählbare Notwendigkeit für den Fortschritt, und natürlich ergibt das Sinn in der Heranführung an die Feinheiten von Stock und Stein, und doch mutiert das vormals frustrierende Erleben in eine geile Wonne. Lonely Mountains ist also dann am besten, wenn es nichts von mir will.
Eines täuscht mich aber immer wieder: die Möglichkeiten der Steuerung. Ich lenke, bremse, beschleunige und sprinte, und dann erinnere ich mich, wie ich damals auf einen zugefrorenen Sandweg gefahren bin mit dem Gedanken, oh, seit wann glänzt Sand so sympathisch, und natürlich bemerkte ich das Eis und die Glätte und das Glatteis und den Glatteissand, leider bemerkte ich es nicht richtig und zu spät, und für eine knappe Sekunde, kurz vor dem Plumps, dachte ich an die Einfachheit des Fahrrads und der damit einhergehenden Bedienung und dass ich ja nur bremsen und lenken und beschleunigen muss, und für diese Torheit lachte mich das Blut an meinem Knie und Ellenbogen schallend aus, also wenn ich mich daran erinnere, weiß ich wieder, wie sehr ich Fahrräder hasse und die „Steuerung“ sowieso und all das auch für dieses Spiel gilt. Jeder kleinste Schub, jedes Bisschen nach links oder rechts kann bereits zu viel sein.
Eine gleichwohl weniger schmerzhafte, aber ähnlich aufgebaute Erkenntnis folgt bei Lonely Mountains: Aus dem wenigen, was da ist, muss man brutal viel machen, sonst knackst das Pixelgenick. Die wilde Fahrt startet also vom Checkpoint neu, und wer gegen Frust keine Resistenzen kennt oder zufällig von nachhallenden Fahrradunfällen geplagt wird und Flashbacks bekommt, wenn er Pflaster mit Pokémon-Motiv sieht, sollte Lonely Mountains trotzdem spielen, weil es einfach so umwerfend hübsch aussehen kann.
Hunderte neue Versuche innerhalb weniger Stunden bleiben nicht unbemerkt im Pulsmesser der Smartwatch und sollte ein besorgter Support-Mitarbeiter der Krankenkasse nachfragen, warum zum Teufel man plötzlich einen Blutdruck von 190 zu Fickdichdochdudrecksspiel hat, sollte man kurz innehalten. So wie ich. Nicht mal annähernd habe ich Lonely Mountains durchgespielt, weil ich an einen Punkt kam, wo der letzte Erfolg nicht im Einklang stand mit dem momentanen Frust. Bald kehre ich zurück, und ich freue mich darauf, weil ich zwischen all der Pein durch die Schmetterlinge im Herbstwald rasen möchte.
Meine Skepsis gegenüber Fahrrädern habe ich bis heute nie ganz abgelegt, und ein Spiel wird daran nichts ändern. Damals: die Feuerwehrmänner und mein Fahrrad und ich, der ganz bestimmt ernst gemeinte Titel meiner Biografie, damals ging es glimpflich aus, es waren „nur“ ein paar üble Prellungen und – um ehrlich zu sein – sorgten die als Entschuldigung gedachten, in Wahrheit aber ekelhaften Süßigkeiten der Autofahrerin für mehr Schmerz, doch es bleibt die Erinnerung an ein Ereignis, bei dem ich jedwede Kontrolle verlor.
Wenn ich zurück denke, wie viele Kilometer ich damals beim Zeitungaustragen radelte, als der Sonntagmorgen noch mit den Nachwehen der Samstagsbesäufnisse rangelte, und wie ich stets in den zweiten Stock des Altenheims zeitlupte, damit ich einem älteren Herrn die Zeitung persönlich geben kann, schließlich hielt sein 94-jähriger Körper den Gang zum Eingang für Verschwendung und ich auch, und so brachte ich ihm die Zeitung und er schenkte mir manchmal fünf Euro und eine Geschichte über seine Kinder, an die ich mich als ebenfalls 94-jähriger gerne erinnern möchte – wenn ich also zurückblicke, verflüchtigt sich die Angst und somit auch der Gedanke an die vielen Beinah-Unfälle, die großen und kleinen Stürze im schoner- und schonungslosen Fahren mit dem BMX. Lange hält das aber nicht.
Die Bilder von den Feuerwehrmännern kehren zurück, wie ulkig das doch klingt!, doch sobald das letzte Standbild sich wieder im Gedächtnis einbrennt, die millisekündlich andauernde Erkenntnis um den bevorstehenden Zusammenprall und die damit einhergehende Angst, diese verfluchte Angst, die schreit: du Idiot hast nicht aufgepasst und die Frau im Auto auch nicht, ihr Idioten!, jetzt zerplatzt dein Kopf auf dem Asphalt, sobald ich alles nochmal durchgehe, spüre ich sie wieder, die Angst, und es ist ihr egal, ob ich auf dem Fahrrad sitze oder in der U-Bahn mein Knie kratze, sie ist dann einfach wieder da und kontrolliert mich.
Und deshalb spiele ich Lonely Mountains: Downhill behutsam. Ich lasse Platz für Erinnerungen. Für die guten. Ich werde wiederkommen, schalte die übrigen Strecken und Bikes frei, probiere mich an den Herausforderungen und chill‘ mit den Berg-Schmetterlingen. Also genau das, was ich zuvor auch schon tat in diesem verflixt schönen Spiel.






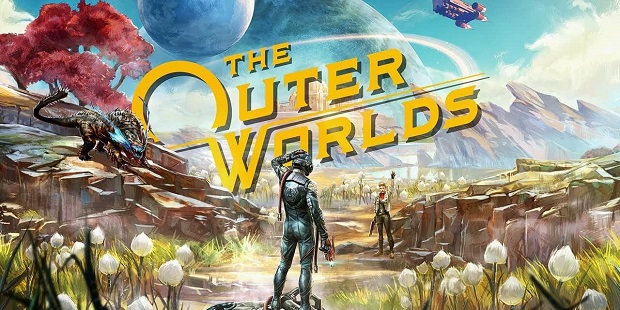









Neueste Kommentare