Meine Mutter war ein toller Mensch.
Leider habe ich ihr das viel zu selten gesagt.
Eigentlich nie.
Warum eigentlich nicht?
Unser Verhältnis war oftmals eher seltsam.
Für sie war ich der große kleine Sohn, auf den sie voller Stolz geschaut hat.
Für mich war sie die Frau mit den großen Stimmungsschwankungen; die meiste Zeit über alle Maßen gesprächig, oftmals schon zu sehr, und in den nächsten Momenten verschlossen. Zurückgezogen.
Von der Welt sowieso.
Wie gern sie rausgegangen ist, durch die Straßen flaniert, sich unter Menschen gemischt hat. Und wie froh sie doch immer war, zuhause ihre Ruhe zu haben. Mit nichts und niemandem etwas zu tun haben zu müssen, als mit der eigenen Familie.
Zumindest kleinen Teilen davon.
Uns. Dem engsten Kreis.
Erstaunlich, wie ähnlich die eigenen Eltern einem doch sein können.
Auch wenn ich normalerweise das Gegenteil von mitteilsam bin. Aber ansonsten ist da schon viel Gemeinsamkeit.
Menschen sind mir schon immer eher zuwider.
Wie gut, dass es Videospiele gibt.
Wie schön, dass ich sie bereits so früh in meinem Leben entdecken durfte.
Wie blöd, dass ich seitdem permanent auf der Suche nach neuen Kicks bin.
Neuen Abenteuern, die mich wirklich fesseln – und sie nur so selten finde.
Wie gut, dass sie meine Kindheit bereichert haben.
Wie dankbar ich dafür bin.
Videospiele waren schon immer meine Flucht aus dem Alltag.
Augen zu und durch?
Wohl eher Augen weit aufgerissen und voller Begeisterung in neue Welten gesprungen, allem anderen entflohen.
Den Hänseleien und Bullis in der Schule, der Markengeilheit und dem Gebashe, weil man selbst immer nur trug, wofür eben das Geld da war. Den Banden im Kindergarten und der abfälligen Grüppchenbildung in der Mittelstufe.
Den Coolen. Den Möchtegerncoolen. Den Losern. Den Ausgestoßenen. Den selbsternannten Ausgestoßenen. Den Nerds. Denen, die dem Druck nicht standgehalten haben. Denen, die bereits unmittelbar nach Abschluss der Mittelstufe genug hatten und im Strick ihren letzten echten Freund fanden. Den Lästerern und Pietätlosen. Den Arschlöchern.
Sind wir das nicht alle? Irgendwie?
Wie groß dagegen die Freude. Das kindliche Erstaunen. Die Faszination. Die unbändige Begeisterung, als Blinky, Pinky, Inky und Clyde das allererste Mal vor meinen Augen über die Mattscheibe flimmerten und verheißungsvoll durch Gänge schwebten, die von mir beschritten, be… knabbert?, erobert werden wollten. Gewinnen oder verlieren? Vollkommen egal! Es ging um viel mehr!
Ein Tor war geöffnet worden. Ein Portal in eine andere Welt.
Neu. Anders. Unbeschreibbarer.
Das hier war die Zukunft! Und ich war mittendrin!
Nicht, dass ich das mit meinen vier Jahren bereits wirklich begriffen hätte. Und doch. Da war etwas. Etwas nicht greifbares. Eine höhere Macht, die gerade im Begriff war, sämtliche meiner Synapsen neu zu verknoten. Einmal alles aufzureißen und neu zu verdrahten.
Von da an war es um mich geschehen.
Meine Mutter hat das irgendwie nie verstanden. Für sie waren Games einfach unbegreifbar. Das Portal, das mich geradezu eingesogen und verschluckt hatte, blieb für sie auf immer verschlossen. Sie versuchte auch gar nicht erst, es zu öffnen.
So gab es immer diese Dissonanz zwischen uns. Auf der einen Seite der Junge, der es liebte, im einen Moment durch die Wälder zu tollen, Bäche zu stauen, Brücken zu bauen, in Bäumen zu klettern, unter Bäumen Häuser zu bauen, Rampen und Parcours für Fahrrad und Kettcar zu errichten, zu Karneval (natürlich) als Cowboy zu gehen, mit zu Schwertern, Lanzen, Bögen umfunktionierten Stöcken die Horde über die Wiese zu führen und mit imaginären Mikrofonen die Hitparade nachzuspielen, nur um im nächsten Moment voller Inbrunst den Computer anzuwerfen und für Stunden im sonnenarmen Zimmer in den Weiten von Giana Sisters, Wonder Boy, Boulder Dash, Bubble Bobble, Turrican, International Karate, The Last Ninja, Maniac Mansion oder Paperboy abzutauchen.
Auf der anderen Seite die Frau, die das von außen vor allem mit Misstrauen beäugte. Der sich die Faszination nicht für ein Mü erschloss. Für die all das zu verstehen nicht möglich war.
Zwei Linien gleichen Ursprungs, die allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz absolut parallel liefen und sich niemals berührten. Aneinander vorbei lebten. Von früh an.
Ich erinnere mich an andere Zeiten.
An Bilder, in denen Games nicht die geringste Rolle spielen.
An endlos erscheinende Diaabende im Kinderzimmer, voller gelbstichiger Erinnerungen an vergangene Urlaube.
An das heimliche Inswohnzimmerkrabbeln, wenn man schon längst im Bett liegen sollte, während Papa im Fernsehen die doch so coolen Karateklassiker schaute Die man nicht sehen sollte, weil man ja am nächsten Tag doch wieder nur als vermeintlicher Ninja schreiend, schlagend und in die Luft kickend durch die Bude rennen würde.
An Sonntagnachmittage voller Beatles-Kassetten.
An knotige Tapetenmuster, nikotinverhangene Gardinen und grünen Sofasamt.
An die langen Autofahrten an die Nordsee, mit der Kühlbox unter den Beinen und den Emissionen zweier Kettenraucher im klimaanlagenlosen Renault.
An ihre liebevollen Arme. Das zärtliche Rückenstreicheln, wenn man als winziger Bube krank im Bett lag. An Nachmittage voller Kopfhörermusik im Sessel vor Papas Stereoanlage, weil man mit angekratzter Netzhaut und Augenklappe zuhause bleiben musste, während sie einen mit Tee und Keksen versorgte. An verzweifelte Hilflosigkeit, wenn man mit gebrochenem Unterarm vor ihr stand.
An das eine Weihnachten, als sie bereits lange vor Heiligabend mit einem nagelneuen, noch eingeschweißten Amiga 600 vor mir stand. Der dann natürlich noch wochenlang unangetastet in ihrem Kleiderschrank liegen musste. Wie sie überhaupt alle Geschenke immer schon Wochen im voraus zusammen hatte. Weihnachten? Das fing bei ihr schon im Sommer ab. Spätestens im September mussten eigentlich alle Vorplanungen vollständig abgeschlossen sein. Gefühlt. In der Realität könnte es vielleicht auch November gewesen sein. Jedenfalls: je früher, desto besser.
Wie schön einfach man bei Ihr auch oftmals erraten konnte, was man denn nun zum Geburtstag oder Weihnachtsfest geschenkt bekam. Einfach ein paar Vermutungen in den Raum werfen und jene, die auf die stärkste Abwehrreaktion stieß, blieb meistens als gesetzt übrig. Und trotzdem wusste sie einen immer wieder zu überraschen.
Wie mit der Erkenntnis, dass Computer- und Videospiele ja sowieso nur die Jugend verderben. Machen halt aggressiv und man würde ja die Katharsis für all die aufwühlende virtuelle Gewalt im wahren Leben suchen. Hatte sie in der Zeitung gelesen. Weiß jemand, ob Herr Pfeiffer früher mal für die NRZ geschrieben hat? Egal.
Die dümmste Antwort, die man vor solchen Anwürfen als pubertärer Macker geben kann, ist natürlich: Wenigstens ballere ich nur in Spielen und nicht in Wirklichkeit.
Tja, so schnell wird man einen Amiga 600 auch wieder los. Inklusive aller Spiele. Und seiner gesamten ASM- und Amiga-Joker-Sammlung. Der Nachbarsjunge hat sich wenigstens gefreut.
Und so stand ich mit zarten 16 plötzlich ohne das dar, was mich einst so fasziniert hatte.
Und komm’ mir bloß nicht auf die Idee, bei Deinen Freunden spielen zu gehen!
Wieviel Angst man doch haben kann, dass einen irgendeiner der Bastarde doch mal bei Mama verpfeift.
Vorbei waren sie plötzlich. Die vielen Tage, an denen ich mit meinem besten Kumpel Jens gemeinsam vor meinem oder seinem Amiga (ja ich weiß: meiner und seiner) saß und wir uns durch Dynablaster, Superfrog, Blues Brothers, Rick Dangerous, Curse of Enchantia, Gobliiins, Lemmings, Lotus I-III, Zool, Magic Pockets, Speedball, Gods, The Chaos Engine und überhaupt das gesamte Bitmap Brothers Oeuvre, Alien Breed, Project X, Apidya, Rainbow Islands, Sensible Soccer, Football Manager, Monkey Island 1 und 2 und so vielem mehr suchteten, bis die Kirchturmuhr zur 19. Stunde schellte und es klar war, dass es mal wieder einen Einlauf gibt, weil ich fünf Minuten zu spät zum Abendessen vor der Türe stehe. Verdammte Videospiele.
Mein Vater ist ja bis heute der felsenfesten Überzeugung, dass wir den ganzen Tag nur vor dem Rechner gehockt hätten. Egal bei welchem Wetter.
Jens und ich hingegen erinnern uns an endlose Tage im Wald, voller Hindernisrennen, Stunden über Stunden und zahllose Kilometer auf dem Fahrrad, an Kinobesuche, ausgiebige Abstecher in den örtlichen Comicladen, an Marvel-Sammelkarten und Taschenbuch-Kleinode, an das Durchstreifen der Stadtteilkerne, Fußball, Tischtennis, Tennis und sonstige Sportlerei auf dem Schulhof, Stöbertouren in der Stadtteilbibliothek und soviel mehr.
Aber so ist das wohl, mit der subjektiven Perzeption. It depends.
Ein Jahr ging ins Land. Ein zweites. Ein drittes.
Keine Videospiele.
Nichts.
Bis zu meinem ersten Ausbildungsjahr. Als einer meiner Berufsschulmitschüler wochenlang nicht anders kann, als mir von seiner neuen Playstation mitsamt MediEvil vorzuschwärmen. Und dann kann ich kurz vor Weihnachten 1998 auch nicht anders als loszulaufen und mir exakt ebendieses Paket ebenfalls zu kaufen. Nur um das wirklich schreckliche MediEvil in Rekordzeit in das soviel bessere Spyro the Dragon umzutauschen.
Trifft sich eh alles super, das. Weil ich Weihnachten alleine auf meinem Zimmer unterm Dach hocken werde, während der Rest der Familie unten gemütliche Beisammenheit zelebriert.
Ich erinnere mich an fast ein komplettes Jahr, in dem meine Eltern und ich praktisch nicht miteinander kommunizieren. Essen ist fertig. Ja schön. Wurde auch Zeit. Sie: Guten Morgen. Ich:… Sie: Kannst Du mal bitte dies und jenes? Ich: Augenrollen. Sie: Gute Nacht. Ich: Schweigend ab dafür. Der Auslöser war so dumm wie dumm: egoistisches Arschlochkind mit überhöhten Ansprüchen trifft auf Eltern, die nach Leibeskräften versuchen, einem alles zu ermöglichen und irgendwann einfach nicht mehr können, als auch mal nein zu sagen, vor all den materiellen Forderungen ihrer eigenen Brut.
Jedenfalls wird Spyro an diesem Weihnachten mein bester Freund. Wie er mit Sparx durch die grüne Landschaft rauscht, Gegner rammt, Schafe röstet und wie Sparx mit dieser putzigen Animation und dem noch putzigeren Haps-Sound die Überreste einsammelt. Einfach zu… nun ja, putzig eben.
Viele weitere virtuelle Freunde sollten folgen. Cloud Strife und Aerith, Crash Bandicoot, Squall Leonhart und Rinoa Heartily, Solid Snake, Lara Croft, Claire und Chris Redfield, Rain Quin, Ash, Edward Carnby… um nur ein paar zu nennen. Allesamt teuer erkauft. Und nicht gebrannt, wie Ihr alle.
Nach der ersten PlayStation folgt im Studium Sonys zweiter Streich und hält auch in meinen 18 Quadratmetern Einzug. Jade wird mich mit Beyond Good & Evil fesseln wie seit Pac-Man nur wenige. Final Fantasy X wird mich mit seinem kopfschüttelwürdigen Blitzball fast zur Gehirnerschütterung treiben. Raiden wird mir in Metal Gear Solid 2 viel besser gefallen als dem Rest der damals schon erschreckend lauten Internettrolle. Gordon Freeman wird mich in seinem ersten Abenteuer erstaunlich kalt lassen. Kratos lässt mich in den ersten beiden God of Wars Ärsche treten wie kein zweiter. Jak and Dexter liefern mit mir Jak II Renegade ein episch rührendes Abenteuer, das ich so niemals erwartet hätte. Ratchet & Clank bringen mein Zwerchfell zum Beben und ICO schließlich wird für immer verändern, wie ich Videospiele sehe.
Plötzlich ist da mehr. Ein neues Portal. Eine neue Welt. Games können auf einmal soviel mehr sein. Berührender. Verstörender. Ergreifender. Versierter. Kunstvoller. Emotionaler. Einfach besser. ICO. Oh, ICO.
Und Mama? Mama ist das alles egal. Ich lebe jetzt alleine woanders, kann machen was ich will. Bin ja schließlich schon groß. Die PlayStation 2 geht, die Xbox 360 kommt. Online-Gaming hält Einzug im Wohnzimmer und wird massentauglich. Ich habe mittlerweile ein erstaunlich gut laufendes Gaming-Blog. Darf irgendwann sogar im Start-Roster von Polyneux Aufstellung nehmen. Das Rudelzocken wird geboren und meine Leser:innen und ich battlen uns in immer neuen Konstellationen in Pure und Split Second, Modern Warfare 1 und 2, Halo 3 und Halo Reach, kämpfen Schulter an Schulter in Gears of War, Kane & Lynch oder Splinter Cell Conviction und tauschen uns rege über den Summer of Arcade aus, der uns Jahr für Jahr mit unzähligen kleinen Perlen versorgt. The Maw, anyone?
Als meine Freundin mich dann verlässt, ist es plötzlich vorbei mit den Spielen.
Vorbei alle Lust am Erkunden, Entdecken, Ballern, Austauschen, Schreiben, Machen und Tun. Vorbei das Interesse an Konsolen, Gaming-News, Blog-Charts und gamescom. 2011 markiert für lange Zeit das letzte Jahr, in dem ich mich wirklich für Videospiele interessiere.
Ob meine Mutter das gefreut hat?
Keine Ahnung, wir haben nie drüber gesprochen.
Wie wir überhaupt wenig darüber sprechen, was ich mache.
Ich sehe mich unzählige Male mitten im Gespräch entnervt auflegen, wenn wir telefonieren.
Ich sehe mich immer und immer wieder genervt die Augen rollen, wenn sie fragt, was ich gerade auf der Arbeit mache. Verzweifle daran, keine Lust zu haben, zu versuchen, ihr meinen Job zu erklären.
Sehe mich frühmorgens auf dem Weg zur Arbeit verärgert den Anruf wegdrücken, weil sie schon wieder Support für ihren Computer braucht oder irgendwas nicht kapiert.
Sehe all die unterlassenen Gespräche vor mir, die zu führen wir nie imstande waren.
All die verpassten Gelegenheiten.
All die liebevollen Momente.
All die Momente des Schweigens.
All die unausgesprochenen Chancen.
Ich sehe, wie sie sich quält, nach ihrer Rücken-OP.
Mache ihr Vorwürfe, weil sie nicht zur Physio geht.
Dabei weiß sie es viel besser.
Ich sehe zwei, drei Jahre voller Schmerzen in ihrem Gesicht.
Sehe wie sie kämpft. Wie sie aufrecht bleibt. Wie sie sich reinkniet.
In ihren Garten.
In ihre Gedichte. Ihre Lyrik. Ihre Veröffentlichungen.
Sehe, wie mich das überhaupt nicht interessiert. Wie ich sie belächle.
Arroganter Wicht.
Sie sieht mich voller Stolz. Ihr großer kleiner Sohn.
Ich sehe ihre Reaktion auf ihre Krebsdiagnose. Höre ihr hoffnungsfrohes Lamento.
Das geht schon alles vorbei. Ab jetzt gehe ich immer zur Vorsorge.
Ich werde vom Telefon geweckt.
Es ist ein Sonntagmorgen. Die Uhr auf dem Telefon sagt ca. 8:15 Uhr.
Außerdem sagt das Telefon, es wäre mein Vater.
Hätte ich nicht erkannt.
Die Stimme klingt so fremd. So anders. So markerschütternd hell.
Weinend, bebend, bibbernd.
Sie bewegt sich nicht. Sie reagiert auf nichts.
Gerade einmal sechs Wochen nach ihrer Diagnose lege ich auf und rufe den Notarzt.
Rufe meinen Vater zurück.
Der Notarzt ist unterwegs.
Das bringt doch auch nichts mehr.
Ich ziehe mich an und fahre erstaunlich ruhig, aber zügig über die Autobahn.
Nach Hause.
Zu Papa und Mama.
Vor mir steht ein in Tränen aufgelöstes Häufchen Elend.
Wir liegen uns in den Armen und heulen wie die Schlosshunde.
Ich sehe drei Polizist:innen, die wie die Orgelpfeifen im Wohnzimmer stehen und versuchen, möglichst nicht da zu sein. Müssen sie aber. Müssen sie immer.
Ich sehe meine Schwester. Bleich. Fahl.
Sieh da nicht hin. Ist alles, was sie sagen kann.
Wir warten auf den Bestatter.
Ach Mama, ich hätte Dir so gerne einmal ICO gezeigt.
Ist so ein Gedanke, der mir dort, in diesem Moment, definitiv nicht kommt.
Stattdessen: Leere und Fassungslosigkeit. Trauer und Wut.
Warum dauert das alles so lange? Wo bleibt der verdammte Bestatter?
Warum gab es keine Chance mehr, uns zu verabschieden?
Wir hätten uns doch noch soviel zu sagen gehabt.
So viele unausgesprochene Worte, Gedanken, Gefühle.
Soviel Dankbarkeit und Liebe.
So viele Gründe, mich zu bedanken.
Für ihre Liebe. Ihre Zuneigung. Ihre Geduld. Ihre Kraft. Ihr Durchhaltevermögen.
So ein schweres Leben. So viele Auf und Abs. Und trotzdem war sie immer für uns da. In all den dunklen Stunden. Wir haben uns nie richtig zu verstehen gewusst und trotzdem hat sie verstanden. Hat so wenig von all den Kämpfen in ihr nach außen gezeigt. Ihre eigenen Dämonen heruntergewürgt, um für uns da zu sein. Komme was wolle.
Sie war immer so stolz auf Dich. Sagt Papa.
Und es bricht mir das Herz.
Ich sehe ein Häufchen Mensch auf der Couch liegen.
Ganz klein. Ganz winzig. Eine Decke darüber gebreitet.
Ich gehe mit dem Hund spazieren.
Raus. Nur raus.
Bei der Beerdigung bin ich erstaunlich gefasst.
Ruhig.
Stehe neben mir.
Kann es nicht begreifen.
Nichts davon geht in meinen Kopf.
Ich sitze zuhause und weiß nichts mit mir anzufangen.
Meine Mama ist tot.
Einfach weg.
Kann keinen klaren Gedanken fassen. Will keinen klaren Gedanken fassen.
Funktionieren. Einfach nur funktionieren.
Augen zu und durch. Diesmal wirklich.
Meine letzte Flucht: spielen. Einfach nur spielen.
Einfach vergessen. Einfach nur spielen.
Spielen für das große, leere Nichts.
Einfach nur ballern.
Ballern, um an nichts anderes denken zu müssen.
Im Stumpfsinn versinken, um nicht verrückt zu werden.
Alle Emotionen aussperren.
Konsole an. Hirn aus.
Und die Welt vorbeiziehen lassen.
Bloß eins möchte ich nicht:
Vergessen.
Niemals.
Gute Nacht, Mama.
Ich hab’ Dich lieb.




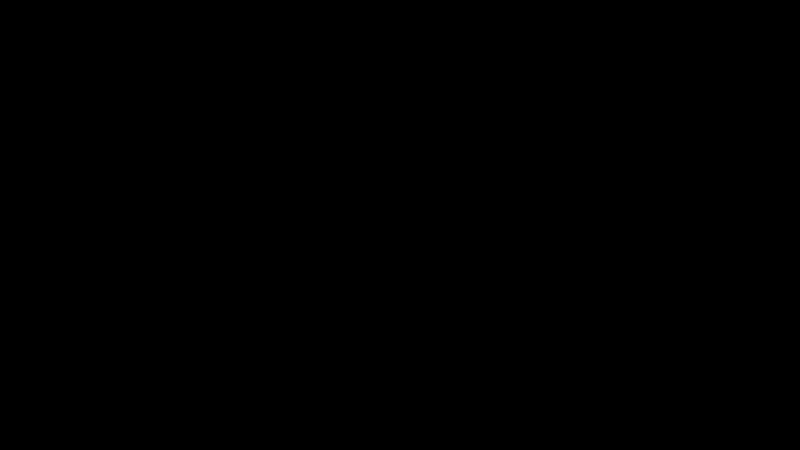










1 Kommentar
Ein bewegender und persönlicher Text, der Gänsehaut verursacht. Und mich an der Stelle auch erinnert, heute noch bei meinen Eltern anzurufen. Danke dafür!